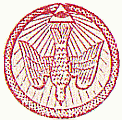pre-Ordo Templi Orientis
Theodor Reuss, 1906
Lingam-Yoni oder
Die Mysterien des Geschlechts-Kultus

[AI generiertes Image]
|
Theodor Reuss’ Büchlein, Lingam-Yoni oder die Mysterien des Geschlechts-Kultus, erschien 1906 unter dem Pseudonym „Pendragon“ im „Verlag Willsson“ – einem Decknamen für Reuss selbst. Laut Titelblatt stützte er sich auf „alte und geheime Dokumente eines Ordens“, tatsächlich handelte es sich aber kaum um mehr als eine Übersetzung bzw. Kompilation aus den Schriften des viktorianischen Phallusforschers Hargrave Jennings (Phallicism, Celestial and Terrestrial, 1884; Illustrations of Phallicism, 1885; Phallism, 1889).
Der Text selbst entfaltet sich in einer einzigen Tonlage: Alles – von indischen Tempeltürmen über christliche Kuppeln bis hin zu den Kreuzen von Palenque oder den Haingöttern der Hebräer – wird auf die dyadische Einheit von Lingam und Yoni zurückgeführt. „Alle diese Türme, Kuppeln und christlichen Tempelgebäude sind Reproduktionen […] des aufrechtstehenden Phallus“ (S. 105). Selbst das Kreuz zerfällt in seine Grundelemente: „der Querbalken […] das weibliche Reproduktionsorgan […] der senkrechte Balken […] das männliche“ (S. 119). Die argumentative Struktur folgt einem kumulativen Prinzip: möglichst viele Beispiele aus unterschiedlichen Kulturkreisen werden addiert, um die behauptete Universalität zu stützen. Die Belege sind nicht systematisch kontextualisiert: Datierungen, lokale Bedeutungen und kulturinterne Quellen fehlen. Vielmehr werden Kreuzformen unterschiedlicher Epochen und Regionen ohne Differenzierung zusammengestellt. Die Methode ist durchsichtig: Wo Quellen mehrdeutige Lesarten zulassen, verengt Reuss den Interpretationsspielraum, bis am Ende jede Symbolik zur Sexualallegorie wird. Viele Textstellen deuten auf eine Grundannahme, dass Fruchtbarkeit/Sexualität das „Ur-Prinzip“ aller Religion sei (implizit S. 105; 119; 123). Diese Leitprämisse steuert die Quellenauswahl. Das ägyptische Crux Ansata mag Lebenszeichen, Nil-Schlüssel oder königliches Emblem gewesen sein – bei Reuss ist es unweigerlich ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ (S. 123). Dass er es zuvor auch als ‚Schlüssel der Hölle und des Todes‘ (S. 122) etikettiert hat, stört ihn nicht: die Vielstimmigkeit der Symbolik wird kurzerhand zur Einbahnstraße umgedeutet – ein Verfahren, das gerade die behauptete Eindeutigkeit untergräbt. Auch das Alte Testament, das Reuss ausschließlich in Luthers Übersetzung zitiert, versieht er kurzerhand mit dem Etikett ‚Lingam-Yoni‘ (S. 126–128). Hier zeigt sich eine systematische Übertragung indischer Terminologie („Lingam-Yoni“) auf den alttestamentlichen Kontext – ohne Beleg aus Primärquellen. So entsteht eine „Universalgeschichte des Phallus“, deren suggestive Kraft aus radikaler Gleichmacherei resultiert, quellenkritisch jedoch auf tönernen Füßen steht. Auffällig ist, dass der Text selbst keinerlei expliziten Bezug zum O.T.O. nimmt. Warum? Es gab ihn noch gar nicht, respektive war er 1906 noch im embryonalen Zustand. Gleichwohl wird in der Anlage die Stoßrichtung erkennbar: die Konstruktion einer angeblich uralten, universalen Sexualmysterien-Tradition, aus der der Orden später sein Selbstverständnis speisen konnte. Inhaltlich ist das Buch weniger religionswissenschaftliche Analyse als vielmehr ein programmatischer Entwurf. Reuss konstruiert eine Traditionslinie, die seinen baldigen O.T.O. als Erben eines angeblich uralten, weltumspannenden Geschlechtskultes ausweist. Seine Beweisführung lebt von Formähnlichkeiten, Analogien und kühnen Umdeutungen, was weniger als Fehler denn als rhetorische Strategie zu verstehen ist: disparate Materialien werden in eine einzige machtvolle Tradition destilliert. Im kulturellen Klima um 1900 war diese Fixierung auf Sexualsymbolik kein Einzelfall. Sigmund Freud hatte bereits Die Traumdeutung (1900) und die Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie (1905) vorgelegt, doch deren Wirkung war noch begrenzt. Eine direkte Freud-Rezeption durch Reuss ist daher unwahrscheinlich. Beide schöpften aus demselben fin de siècle-Diskurs, der Sexualität als „Urgrund“ religiöser wie psychischer Phänomene verstand. Freud untersuchte Träume und Neurosen, Reuss Tempel und Sakramente. Gemeinsam war beiden die phallozentrische Deutungslust, doch methodisch und institutionell liefen ihre Strömungen auseinander. Mit der Ernsthaftigkeit eines viktorianischen Kompilators entwarf Reuss eine Theorie des „universalen Phallus“, die er zugleich zur Legitimation eines modernen okkulten Ordens heranzog. Lingam-Yoni gibt sich als religionswissenschaftliche Aufklärung, wirkt bei näherem Hinsehen jedoch wie ein Manifest über die Ursprünge des eigenen Vereinslebens. Die „Mysterien des Geschlechts-Kultus“ erklären weniger die alten Religionen, als dass sie die Selbststilisierung des O.T.O. vorbereiten. |
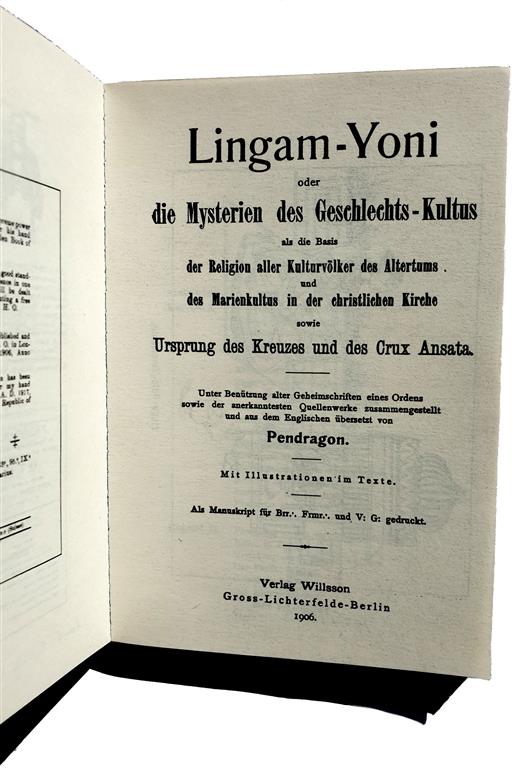
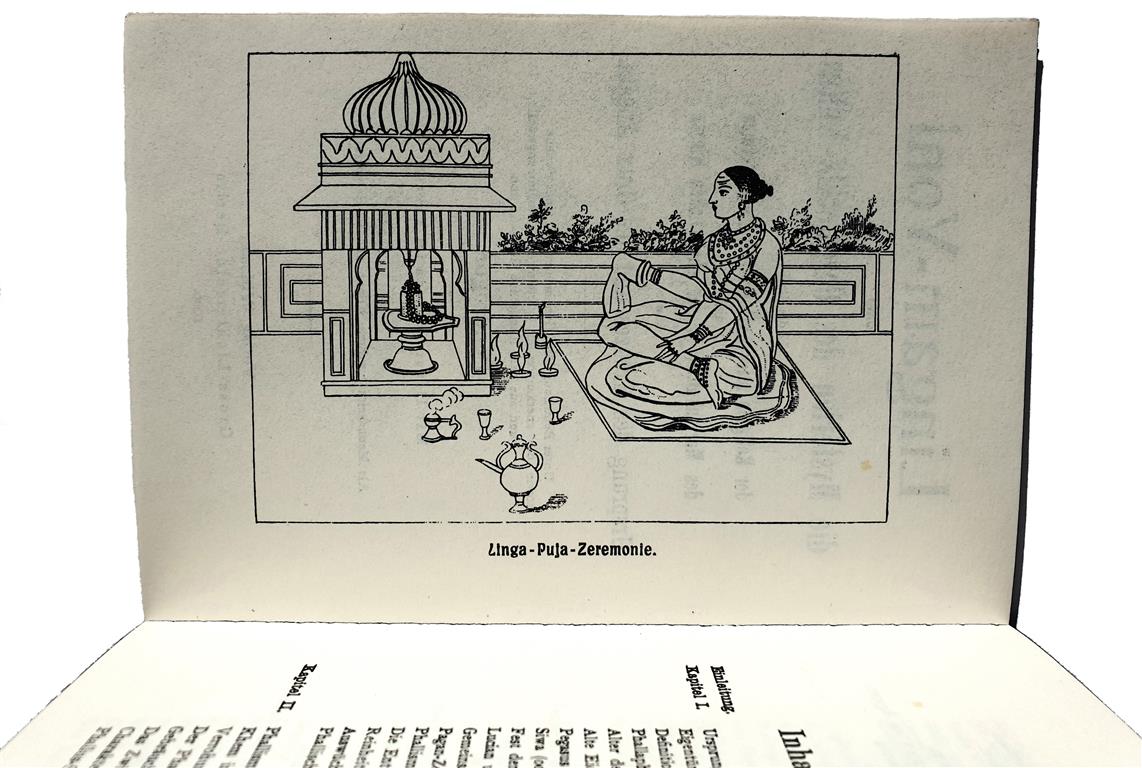
I. Abteilung.
Inhalts-Verzeichnis. Einleitung. Kapitel I. Ursprung des Gegenstandes des Werkes. Eigenthümlichkeit desselben. Definition von Phallusdienst. Phallaphoroi. Alter des Phallusdienstes. Alte Eidesformel. Pegasus und die Bacchus-Statuen. Siwa (oder Schiwah) und Prakriti. Fest der Fackel. Lucian und die syrische Göttin. Gemeinsamer Ursprung des Paganismus. Pagan-Zeremonien. Phallismus in Dahome. Die Entwicklung des Phalluskultus. Reinheit des Ursprungs. Auswüchse und Missbrauch. Phallische Anklänge in England. Kapitel II. Phallismus in den verschiedensten Ländern. Khem in Aegypten. Verrohung des Kultus in Aegypten. Der Phallus-Schwur. Gebräuche in Wales. Das Zwitter-Element. Charakter des Phallus. Phallus-Symbole der Gegenwart.Herodot und Bacchanalien. Priapus in Rom und Griechenland. Maachah, ein Priapus-Verehrer. Belphegor. Auswüchse des Priapusdienstes. Herkunft des römischen Priapus aus Aegypten. Catullus über Priapus-Verehrung. Formen des Priapusdienstes. Phallismus im allgemeinen. St. Augustinus. St. Fontin und Priapus. Phallismus in Frankreich. Neapolitanische Feste. Der Maibaum in Indien und Europa. Kapitel III. Phallismus in Indien. Phallus-Verehrung in Asien. Linga. Die Höhlen von Elephant. Lucian und der Tempel von Hierapolis. Zeremonie von Linga-puja. Die Frauen und der Lingadienst. Die Hindu und Kindersegen. Hochzeits-Tempel. Minderwerthigkeit der kinderlosen Frauen. Schravana und Dasaratha. Die zwölf Lingas. Argha. Stein-Verehrung. Unreine, entweihte Brahmanen. Brahmanen und Feuer. Fehde zwischen Linga- und Yoni-Verehrer. Sarti und Parvati. Kapitel IV. Mahadeva-Legende. Diodorus Siculus über Osiris. Ptolemäus Philadelphus. Die Vaishnavas. Hindu-Sekten. Seite 6 Anbetung der Matrix. Die weibliche Reproduktions-Verehrung. Fakirs und die Hindu-Frauen. Macht und Einfluss des Phallismus in Indien. Ursprung des Phallusdienstes in Indien. Hindu-Gebete. Kapitel V. Vergleiche zwischen Aegypten und Indien. Hindu-Soldaten in Aegypten. Brahm Atma, die atmende Seele. Wachstum der Hindu-Religion. Siwa-Verehrung. Benares. Lingayet. Eigenthümlichkeiten der Hindu-Symbole. Unparteiisches Urtheil über dieselben. Hinduismus als unsittlich verurtheilt. Kapitel VI. Crux Ansata und das Kreuz. Irrige Ansichten über das Kreuz. Heidnischer Ursprung des Kreuzes. Monumente und Grabdenkmale. Unveränderte Form des Kreuzes. Wirkliche Herkunft des Kreuzes. Das Kreuz im alten Amerika. Die Mond-Stadt. Das Malteserkreuz in vorchristlichen Zeiten. Dänische und indische Kreuze. Alte britische Kreuze. Ursprung des christlichen Kreuzes. Crux Ansata beschrieben. Alter desselben. Angebliche Bedeutung desselben. Der Nil-Schlüssel. Phallische Abstammung. Die Nil-Schlüssel-Theorie analysirt. Das Kreuz in alter biblischer Zeit. Crux Ansata das Symbol der Symbole. Crux Ansata als religiöses Symbol. Seite 7 Kapitel VII. Die Hebräer und Phallismus. Salomon und die heidnischen Götter. Alttestamentliche Charaktere. Die Verehrung von Hainen. Geweihte Säulen. Jakobs Säule zu Bethel. Phallusdienst bei den Hebräern. Ascherah und der Hain. Aschtoreth. Jüdischer Lingam. Salomons Laster. Baals Dienst. St. Hieronimus über Baal-peor. Jüdische Ansichten über Baal-peor. Götze Maachah. Seite 8
Einleitung.
Das Alte fällt und neues Leben blüht aus den Ruinen. Im Sinne dieses Ausspruches sage ich: Unsere Zeit ist eine Zeit des Überganges. Alte Ideen, alte Sitten, alte Anschauungen und Lebensgrundsätze verschwinden nach und nach, und neue Sitten, neue Ansichten und Lebensnormen, sogar eine neue Religion scheinen sich nach und nach aus unserer modernen westlichen Kulturgerährungsbewegung herauszubilden. Es ist nur natürlich, dass dieser Gärungsprozess auch wunderliche Blasen treibt, stellenweise sogar sehr viel Stinkgas entwickelt, ich brauche nur auf das ganz unheimliche Anwachsen der pornographischen Literatur, welche ihren Höhepunkt in »Karl Hetmann« erreicht haben dürfte, und auf die Dekadenz in den darstellenden und graphischen Künsten hinzuweisen, aber im Grunde genommen sind das doch bloss Begleiterscheinungen einer Periode des Werdens einer neuen Weltanschauung, vielleicht einer neuen Welt! Und wie im Grundgenommen trotz aller Neubildungen, trotz allen neuen Werdens es doch nichts absolut Neues gibt in der Welt, so knüpft auch die »neue« Weltanschauung, die neuen Sitten, die neue Religion an Altes an! Das Perverse in all den Auswüchsen modernsten Gärens ist aber in seinem Urgrund doch »göttlichen« Ursprungs, sie ist eine unbewusste Anknüpfung an die Urreligionskulten der ältesten Kulturvölker unserer Erde, eine meistens unbewusste Wiederbelebung des alten Geschlechtskultus in modifizierter Form. Angesichts des Umstandes, dass aber noch heutzutage über 120 Millionen Menschen, von denen über 100 Millionen Untertanen des Königs von England sind, einem Geschlechts- (Lingam-Yoni) Kultus anhängen, und trotz aller Bemühungen der christlichen Kirche diese Religion nicht aufgeben, entspricht es gewiss einem wahren Bedürfnis, authentisches Material über den Phallismus weiteren Kreisen zur Kenntnis zu bringen, und so gleichzeitig auch einen richtigeren und gerechteren Massstab zu finden, für die in ihren Auswüchsen zwar zu verdammende, in ihrem innersten Kern aber alte Gottes-Verehrung wiederbelebende, moderne Geschlechtskultusbewegung. Die Veröffentlichung dieses authentischen Materials dürfte ferner umsomehr angezeigt sein, als ja auch die katholische Kirche den Phallus-
dienst und den Lingam-Yoni-Kultus, wie so manches andere aus den sogenannten heidnischen Religionsgebräuchen, in versteckter Form mit übernommen hat, und im Marienkultus noch heute übt und perpetuiert.
Der Gegenstand, den wir in nachfolgendem Werke, das in sieben Bändchen zu je sechs Bogen erscheint, behandeln werden, entspringt zwar einem gemeinsamen Quell, hat eine gemeinsame Wurzel, aber sehr viele Zweige, die manchmal höchst komplizierte Formen zeigen. Der Kultus, dessen Beschreibung gegenwärtiges Werk gewidmet ist, stammt aus dem allergräusten, vorgeschichtlichen Altertum, war der herrschende Religionskultus während der höchsten Blüte der Kulturstaaten des klassischen Altertums, und ist noch ein lebender Faktor in unserer Zeit. Er ist verwoben mit der Entwicklung der grössten und mächtigsten Reiche der Welt, von denen die Geschichte uns berichtet, und heute noch auf das innigste verbunden mit den Sitten und dem religiösen Leben ganzer Völker, die zum grossen britischen Weltreich gehören.
Unser Material stammt zum Teil aus den geheimen, sozusagen heiligen Büchern eines alten Ordens, der seine Abkunft von den Aegyptern, Chaldäern und den Ureinwohnern Indiens ableitet, zum anderen Teil aber aus den
anerkanntesten Quellen unserer berühmtesten Forscher auf dem Gebiete der Kulturhistorik und Archäologie.
Als Beweis für unsere Behauptungen werden wir nicht nur alte Schriften oder mündliche Überlieferungen heranziehen, sondern auch noch existierende Monumente, Skulpturen, Steine und, für viele bisher räthselhaft gewesene, Inschriften und Symbole.
Ein derartiges Werk ist natürlich nicht für junge, unreife Personen bestimmt. Erwachsene Personen beiderlei Geschlechts können jedoch nur an allgemeinem Wissen und Verständnis der Welt, sowie der Menschen und deren Sitten und Gebräuche durch das Studium des von uns zu veröffentlichenden Materials gewinnen. Mancher Tartüff wird uns zwar ganz gewiss »Unsittlichkeit«, »Vergiftung der Moral« u. s. w. vorwerfen. Darauf sind wir gefasst, und erklären wir schon jetzt, dass dergleichen Angriffe uns nicht im geringsten Grade unangenehm sein werden. Dass bei der Behandlung eines Gegenstandes, wie es unser Werk bieten wird, manches berührt und beschrieben werden wird, das »Lüstlinge« beiderlei Geschlechts zu perversen Gedanken anregen kann, und wohl auch anregen wird, ist natürlich, kann uns aber nicht als Schuld treffen. Dem Reinen ist bekanntlich alles rein!
Zu einer Zeit, da das östlichste Reich, und jetzt mächtigster Vertreter sogenannten Heidentums, unseres Globus das mächtigste orthodoxe Reich des Abendlandes auf dem Schlachtfelde besiegt und blutig niedergeworfen hat, steht es uns Abendländern nicht mehr an, über die wilden Heiden da hinten im fernen Asien unsere Nase zu rümpfen, sondern es wird gut sein, zu bedenken, dass bald auch die Zeit kommen wird, einer neuen Völkerwanderung gleich, die Völker Indiens, durch die sich ausbreitenden Chinesen und Japaner verdrängt, an die Pforten Europas klopfen werden, und es wird sich dann zeigen, ob die christliche Religion in den abendländischen Völkern noch genügend Gottesglauben und Widerstandsfähigkeit gelassen haben wird, um die anstürmenden Massen der dem Geschlechtskultus dienenden Völker Asiens erfolgreich abzuweisen.
Um unseren europäischen christlichen Völkern eine derartige innere Widerstandsfähigkeit, die nur aus festem Gottesglauben fliesst, zu geben, wird es notwendig sein, die vielen Millionen von Schein-Christen dem alten christlichen Gottesglauben zurück zu gewinnen, oder aber eine neue Art Gottesglauben muss in deren Herzen feste Wurzeln gefasst haben. Wenn an Stelle des heutigen krassesten »Unglaubens« dann ein
»wirklicher lebendiger Glaube an eine Gottheit« getreten sein sollte, so würde es diesem neuen Gottesglauben keinen Abbruch tun, wenn selber sich sogar in einer Art symbolischen Phallusdienstes äussern sollte. –
Auf alle zukünftigen Verdächtigungen und Anschuldigungen antworten wir aber heute schon:
Honny soit, qui mal y pense!
Lingam-Yoni oder Phalluskultus.
KAPITEL I.
Ursprung des Gegenstandes des Werkes. Eigentümlichkeit und Charakter desselben. Definition des Wortes Phallusdientst. Phallophoroi. Phallephoria. Phallikos. Alter des Phallusdientes. Alte Eidesformel bei den Hebräern. Abraham. Pegasus und die Bacchus-Statuen. Siwa (oder Schiwah) und Prakriti. Fest der Fackel. Lucian und die syrische Göttin. Gemeinsamer Ursprung des Paganismus. Paganzeremonien. Phalluskultus in Dahome. Die Entwicklung des Phalluskultus. Reinheit des Ursprungs. Auswüchse und Missbrauch. Phallische Anklänge in England.Der Gegenstand, mit dem dieses Werk sich beschäftigen wird, ist von so eigentümlichem Charakter, so umgeben und eingehüllt in mystisches Dunkel und Unwahrscheinlichkeit, dass viele wohl bereit sind, das, was wir in diesem Buche beschreiben werden, als unmöglich und unglaubwürdig zu verurteilen, wenn wir nicht eine Unmasse von unwiderlegbaren Beweisen für die Tatsachen, die wir zur Kenntnis unserer Leser bringen werden, aufzuführen imstande sein würden. Nicht nur Schriften und Gebräuche, sondern auch Monumente, Denkmäler, symbolische Steine und bisher rätselhafte Inschriften werden unsere Mitteilungen stützen und bekräftigen.
Gleichviel wie unsere heutige Gesellschaft, die Vertreter der Lehre der christlichen Kirche, die Männer der staatlich privilegierten Wissenschaft u. s. w. über die Sache eben denken mögen, gleichviel wie verdammenswert auch die Auswüchse und sexuellen Missbräuche des Urgedankens sein mögen, so bleibt es doch eine nicht wegzuleugnende Tatsache, dass die Verehrung der männlichen und weiblichen Reproduktionsorgane die Basis der Religionen aller Kulturvölker des Altertums bildete, von hundert Millionen Menschen heute noch die Religion ist, und Spuren und Anklänge davon sogar in den höchst entwickelten christlichen Religionen unserer Tage noch zu finden sind.
Die Anbetung der männlichen und weiblichen Reproduktionsorgane muss als die älteste Form eines Gottesdienstes angesehen werden.
Diese Anbetung oder Verehrung der Reproduktionsorgane als Symbole der ewig sich erneuernden göttlichen Ur-Schöpferkraft ist Phallismus, Phalluskultus oder Lingam-Yoni-Dienst. Das Wort Phallos ist ein griechisches Wort und bedeutet das männliche Zeugungsorgan (membrum virile), daher Phallismus oder Phallusdientst. Phallos war insbesondere eine plastische Reproduktion des männlichen Zeugungsorgans, das bei den Prozessionen der Bacchusfeste als Symbol der schöpferischen Naturkraft öffentlich herumgetragen wurde. Man hatte im Griechischen verschiedene Worte und Ausdrücke für denselben Gegenstand, wie z. B. Phallephoria, Phallikos. Ferner wurden die Priester des Phallusdientstes
Phallobates genannt, und Ithyphalloi waren Männer als Frauen verkleidet, die unmittelbar hinter dem Phallus in den Prozessionen des Dionysius einherzogen. Dann finden wir die Bezeichnung Phallaphoroi als Namen für Männer in Schaffellen gekleidet, das Gesicht mit Russ oder schwarzer Farbe beschmiert, die in den Strassen umherliefen, Veilchen, Efeu, Kräuter aus kleinen Körbchen verkauften und kleine Nachbildungen des Phallos, aus rotem Leder gefertigt, umhertrugen. Das Wort ist zusammengesetzt aus Phallos, ein Stab oder eine Stange mit einem Penis am Ende, und aus Phero, ich trage.
Zwei Merkmale sind es, die beim Studium der Geschichte des Phallusdientes besonders hervortreten und unsere Aufmerksamkeit fesseln. Das hohe Alter des Phallusdientes und die ungeheure Ausdehnung, die derselbe über alle Teile der Erde gehabt hat.
Betreffs seines Alters ist es unmöglich, irgend einen historischen Datum oder eine bestimmt zu definierende Zeit als die Entstehungszeit des Phallusdientes zu bezeichnen, man weiss eben nur, dass er schon im vorgeschichtlichen grauen Altertum vorhanden war. Und was seine Ausbreitung anbetrifft, so war während vieler Jahrtausende der Phallusdientst der herrschende Religionskultus in den höchstentwickelten und menschenreichsten Staaten der betreffenden Zeiten der Erde. –
Richard Gough schrieb im Jahre 1785: Diejenigen, welche in das Dunkel der indischen Mythologie eindringen, finden, dass in den indischen Tempeln ein Gottesdienst geübt wurde, der ähnlich dem
Gottesdienst aller anderen Nationen der Welt war, und zwar wie er sowohl in den Zeiten deren Entstehens, wie zur Zeit ihrer höchsten kulturellen Blüte geübt wurde. Göttliche Verehrung wurde bei den Asiaten dem Phallus gezollt, bei den Ägyptern, Griechen und Römern dem Priapus, bei den Kanaaniten und den götzendienenden Juden dem Baal-Peor. Das Bild eines Phallus kann man in der Wanddekoration sehen, welche in Form eines Bandstreifens rund um den Zirkus zu Nimes läuft, ferner über dem Portal der Kathedrale von Toulouse und verschiedener Kirchen in Bordeaux. Der französische Forscher d’Ancarville hat zwei Bände geschrieben, um zu beweisen, dass Phallus-Verehrung die älteste Form der Gottesverehrung ist. Derselbe Autor behauptet, dass die Deifikation Bramas, genannt „Friedensprinz“, (Schiwah) Siwa oder „Mahadeva“ im Jahre 3553 vor Christi Geburt stattgefunden habe.
Mitte des 19. Jahrhunderts fand man in einer Höhle in der Provinz Venedig, damals noch unter österreichischer Herrschaft, ein Knochenhaus, und unter post-tertiären Überresten neben einer Nadel aus Knochen eine Tontafel, auf der in den rohen Umrissen ein Phallus eingekratzt war. Das ist das älteste bisher bekannte graphische Dokument für das Ur-Altertum der Phallus-Idee.
Als die nächstälteste zu bestimmende Periode für die Verehrung des Phallus kann man auf Grund der Bibel die Zeit Abrahams anführen. Um einem Eide bindende Kraft zu geben, legte man den Schwur derart ab, dass der Schwörende die Hand unter den Phallus desjenigen legte, der den Schwur ablegen
liess oder annahm. Im 1. Buch Moses (Gen. 24, 2, 29) heisst es: Lege deine Hand unter meine Hüfte u. s. w. Der Ausdruck „Hüfte“ ist eben nur eine Umschreibung für die oben beschriebene Handlung. Diese Form des Eides fand darin seine Erklärung, dass man das männliche Zeugungsglied als den geheiligten, edelsten und wertvollsten Teil des menschlichen Körpers betrachtete, indem es das Symbol der Vereinigung für die zartesten Beziehungen der ehelichen Verbindung war, der Sitz der Reproduktion des Geschlechtes und der Erhaltung der Familie, des Volkes, der Rasse war. (Gen. 46, 26; Exod. 1, 5; Richter 8, 30.)
Mit der Entwicklung dieser Ansicht wurde das Zeugungsglied als Symbol des Schöpfers und Gegenstand göttlicher Verehrung bei allen Völkern des Altertums, und aus diesem Grunde verlangte Gott einen Teil desselben als Unterpfand und Zeichen des Bundes zwischen Ihm und Seinem auserwählten Volke in der Zeremonie der Beschneidung. Daraus ergibt sich, dass man durch nichts einen Eid heiliger und feierlicher machen konnte, als dadurch, dass man das Symbol der Schöpfung, das Zeichen des Bundes mit Gott, die Quelle der Nachkommenschaft beim Schwur in die Hand nahm. Denn aus dieser Quelle konnte der hervorgehen, der den eventuellen Bruch des Eides an dem Schwörenden in späterer Zeit zu rächen imstande sein konnte.
Bei Aristophanes finden wir folgende Erzählung, die eine Erklärung über die Herkunft der Phallus-Verehrung bei den Bacchusfesten in Athen geben soll. Ein Boiotier namens Pegasus brachte einstmals einige Statuen des Bacchus nach Athen, wurde aber von den Athenern mit grösster Verachtung behan-
delt und der äussersten Lächerlichkeit preisgegeben. Die Gottheit, aufgebracht und empört über die ihr angetane Schmach, rächte sich an den Athenern dadurch, dass sie alle männlichen Einwohner Athens mit einer epidemischen Krankheit heimsuchte, die im männlichen Glied ihren Sitz hatte. Als man nun das Orakel befragte, wie man die Ausbreitung dieser schmerzlichen und abscheulichen Krankheit am besten verhindern und Heilung von derselben erlangen könnte, wurden die Athener angewiesen, Bacchus mit all dem seinem Ritus eigenen Pomp und unter Beobachtung aller Zeremonien seines Gottesdienstes in die Stadt einzuholen und in öffentlichen Prozessionen umherzutragen. Die Weisungen des Orakels wurden befolgt, und um die beleidigte Gottheit noch weiter zu besänftigen und Abwendung der Epidemie zu bewirken, wurden als Opferzeichen Nachbildungen des Phallus auf Stangen in der Prozession des Gottes mit umhergetragen.
Eine ähnliche Sache wird im 1. Buch Samuelis (5 und 6) beschrieben. Die Philister hatten die Bundeslade geraubt. (Die Bundeslade wird von den Eingeweihten als Symbol für das weibliche Reproduktionsorgan betrachtet.) Als Strafe dafür wurden sie zu einem heimlichen Ort (den Geschlechtsteilen) von einer verheerenden epidemischen Krankheit befallen. Sie befragten darauf ihre Priester, wie sie die Seuche abwenden könnten. Die Priester trugen ihnen auf, unter anderen Sühneopfern fünf goldene Abbildungen des mit der Krankheit befallenen Körperteiles zu machen und selbe dem Gott Israels zu weihen. Das taten sie, und so wurden die Philister von der Seuche wieder befreit.
Die Hindus haben folgende Legende bezüglich des gleichen Gegenstandes. Eine Anzahl religiöser Hindus hatten vor langen, langen Jahren wegen ihrer grossen Frömmigkeit im Volke den Ruf der Heiligkeit erlangt und genossen hohes Ansehen und Verehrung. Aber im Inneren ihres Herzens waren diese frommen Leute nicht rein, und ihre geheimen innersten Gedanken und Beweggründe waren nicht in Übereinstimmung mit ihren äusseren Handlungen und ihren frommen Worten. Äusserlich bekannten sie sich zur Armut, aber innerlich geizten sie nach den Schätzen dieser Welt. Die Prinzen und Edlen des Landes sandten ihnen fortwährend Geschenke. Äusserlich schienen sie sich von der Welt und deren Genüssen abzuschliessen, aber in ihren Wohnungen waren sie übel Wohlleben ergeben und hatten zahlreiche Konkubinen. Da den Göttern aber nichts verborgen bleibt, so beschloss Schiwa (Siwa), die Heuchler der öffentlichen Schande preiszugeben. Schiwa veranlasste Prakriti (Natur), ihn zu begleiten, und er selbst nahm die Gestalt eines lieblich aussehenden Pandaram an. Prakriti nahm die Gestalt eines Mädchens von unbeschreiblicher Schönheit an. In dieser Gestalt begab sich Prakriti an den Ort, wo die scheinheiligen Frömmler mit ihren Schülern und Anhängern versammelt waren, um beim Aufgehen der Sonne ihre rituellen Gebete und Waschungen vorzunehmen. Als sie sich denselben näherte, blähte der frische Morgenwind ihre Gewänder und verriet den Versammelten ihre herrlichen und köstlichen Formen, die die Gewänder eigentlich verbergen sollten. Mit züchtig niedergeschlagenen Augen, doch manchmal unter den Augenlidern hervor einen
schwärmerisch scheuen Blick werfend, bat sie mit bezaubernder Stimme, zu den Morgenopfern zugelassen zu werden. Die Frömmler massen sie zuerst mit Erstaunen, dann aber schienen sie ihre Blicke nicht mehr von der entzückenden Erscheinung abwenden zu können. Die Sonne erschien, aber die Reinigungszeremonien waren vergessen, man dachte nur mehr an die Verehrung der so Liebliche. Sie vergassen ihre sonstigen angenommenen würdevollen Manieren und umschwärmten sie wie die Fliegen eine Lampe, die vom Glanze des Lichtes geblendet werden. Sie überhäuften die Liebliche mit Fragen, woher sie käme, wohin sie ginge, beschworen sie zu bleiben, baten sie, ihnen lieber den Tod zu geben, als sie wieder zu verlassen; flehten sie an, sie möge ihnen gestatten, ihr als Sklaven zu dienen, sie in der Betrachtung ihrer Schönheit vergehen zu lassen — und hier versagte den Frömmlern die Stimme, die Seele schien ihnen zu entfliehen, die öffentlich zur Schau getragene Askese und alle Schwüre waren vergessen, die Politik der Scheinheiligkeit war mit einem Schlage vernichtet.
Während die Frömmler fern von ihren Behausungen sich ihrer entfachten Leidenschaft hingaben, begab sich Schiwa in die Dörfer der Frömmler, spielte ein musikalisches Instrument und sang dazu nach Art der frommen Bettler. Der Klang seiner Stimme veranlasste die Frauen, ihre Häuser zu verlassen, um den Sänger zu sehen. Da er so schön und herrlich anzusehen war wie Krischna von Matra (der Apollo der Hindu), verloren die Frauen ihre Sinne. Einige warfen ihm ihr kostbares Geschmeide zu, andere warfen ihre Gewänder ab, ohne sich
darum zu kümmern, dass sie damit den Ort der geheimen Freuden und Vergnügungen entblössten, den sie sonst eifersüchtig verhüllten. Alle aber umdrängten den jugendlich schönen Sänger und baten ihn zu bleiben, damit sie ihm dienen und Freuden geniessen lassen könnten. Der Pandaram fuhr fort zu spielen und die Liebeslieder von Kama, Krischna und Gopia zu singen, und mit Lächeln, gefüllt vom süssesten Verlangen, führte er die Frauen in einen nahe gelegenen Hain, der dem Vergnügen und der seligen Zurückgezogenheit gewidmet war. Die Sonne begann den Abendhimmel zu vergolden, worüber die Frauen nicht böse waren.
Der Verschwendung im Vergnügen folgt das Verlangen nach Ruhe. Schlaf schloss die Augen und beruhigte die Sinne. Als der Morgen erschien, war der Pandaram verschwunden. Verschämt und beschämt schlichen sich die Frauen in ihre Häuser. Um dieselbe Zeit kehrten die scheinheiligen Männer von ihren Vergnügungen mit Prakriti zurück. Die Tage, die folgten, waren Tage der Verlegenheit und Beschämung. Das Volk merkte jedoch nunmehr, dass die Frömmler nicht die heiligen Leute waren, für die sie gerne gehalten wurden, und dass deren Weissagungen nicht eintrafen. Nach und nach verliessen die Schüler und Anhänger selbe, und die Prinzen und Noblen sandten keine Geschenke mehr. Die Frömmler sammelten sich endlich in ernster Konzentration und entdeckten so, dass Schiwa selbst der Urheber ihrer Blossstellung gewesen war. Sie suchten sich nun an Schiwa zu rächen, indem sie Zauberopfer brachten und Beschwörungen vornahmen. Da aber alles nichts nützte, sammelten sie
alle ihre guten Werke, Gebete, Opfer und Bussen und verlangten dafür nur das eine, dass ein verheerendes Feuer Schiwas Zeugungsorgan vernichten solle. Entrüstet über diesen Wahnwitz der Frömmler kehrte Schiwa das erflehte Feuer gegen die ganze menschliche Rasse, und dieselbe würde wohl bald ausgerottet gewesen sein, wenn nicht Wischnu, alarmiert über die drohende Gefahr, Schiwa veranlasst hätte, seiner Wut Einhalt zu tun. Schiwa liess sich erbitten, aber er befahl, dass fortan in seinen Tempeln die Körperteile verehrt werden sollten, die die Frömmler bei ihm zu vernichten versucht hatten.
Manche Forscher glauben den Ursprung des Phalluskultus, sowohl des indischen wie des ägyptischen Zweiges desselben, in Syrien suchen zu müssen. Diese Gruppe von Forschern beruft sich auf Lucians Schrift über die syrische Göttin Myllita. In dieser Schrift teilt Lucian mit, dass bei den alten Syrern das höchste und heiligste Fest „das Fest des Scheiterhaufens oder Fest der Fackel“ oder kurzweg „Fest des Feuers“ war. Der Name dieses Festes ist verschieden übersetzt worden. Es wurde beim Beginn des Frühlings in Hierapolis gefeiert, und die dabei üblichen Opfer und Gebräuche waren von der ausschweifendsten Art. Alles war dabei im grössten Massstabe und mit der grössten Verschwendung angelegt, Tausende von Bewohnern der Umgebung und benachbarten Gegenden strömten zu diesen Festen in Hierapolis zusammen, und um die Feierlichkeit und den Glanz der Feste zu erhöhen, brachten sie sogar noch ihre eigenen Götter mit. Die merkwürdigste Seite der Zeremonien dieses Festes war jedoch, dass, nachdem sich die Priester gegen-
seitig gegeisselt und mit Messern blutig geschnitten hatten, einige derselben nicht eine Nachahmung des Phallus, sondern den eigenen richtigen Phallus der Göttin als Opfergabe darbrachten. Einer der jungen Männer (oder auch mehrere) wurde im Verlaufe der Zeremonie auf einmal von einem Paroxismus befallen, riss sich die Kleider vom Leibe, sprang unter die versammelten Galli, raffte eine Art Dolchmesser (das zu diesem Zwecke jedenfalls daselbst immer bereit gehalten wurde) auf, schnitt sich damit seinen eigenen Phallus ab und rannte mit dem abgeschnittenen Glied in der Stadt umher. Die Bewohner desjenigen Hauses, in das er das Glied warf, mussten ihn mit einer ganzen Garnitur Frauenkleider versorgen und ihm allen Schmuck schenken, den zu tragen für eine Dame üblich war und wie es ihrem Stande entsprach.
Dieser greuliche und verabscheuungswürdige Akt der Selbstverstümmelung hatte eine zweifache Begründung und Erklärung. Erstens sollte damit das geopfert werden, was dem Menschen das Wertvollste und Wichtigste ist, das Organ zur Vollziehung des göttlichen Schöpfungsaktes; zweitens wollten die Überfanatisierten einen öffentlichen Beweis ihrer zukünftigen lebenslänglichen »Jungfräulichkeit«, die wieder aus anderen mythologischen Gründen von Menschen erstrebt wurde, geben.
Die syrische Göttin kann man als Personifikation der gebärenden Erde, als die Cybele der Griechen betrachten. Der ohrenbetäubende Lärm bei diesen Festen hatte auch symbolische Bedeutung. Es sollte damit angedeutet werden, dass konvulsive Vorgänge im Innern der Erde stattfinden, bis es zur Geburt von Leben kommt. Bei den Festen der Dea Syria
der Babylonier fanden dieselben Instrumente, Geräte, Gegenstände Verwendung, wie bei den phallischen Festen und Zeremonien der Indier. Bei den letzteren reicht deren Anwendung und Verwendung bis in die grauesten vorgeschichtlichen Zeiten und sind unwiderleglicher Beweis dafür, dass seit undenklichen Zeiten die Schöpfungskraft im Zeugungsorgan anstatt des Schöpfers selbst göttliche Verehrung genoss.
Von Eingeweihten wurde jedoch der Göttin eine weit universellere Bedeutung gegeben. Sie war diesen Eingeweihten die Personifikation der Universal-Urkraft. Dieser Charakter der Gottheit fand rituelle Verehrung und Ausdruck in einer anderen merkwürdigen und ganz eigentümlichen Zeremonie und merkwürdigem Gebrauch. Dieser Gebrauch erinnert an die tanzenden Mädchen Indiens, die öffentliche Freimädchen waren, aber Gottesfrauen genannt wurden. Alle weiblichen Anbeter und Verehrer der Göttin Mylitta, sowie alle ihre weiblichen Geweihten mussten sich mindestens einmal in ihrem Leben in den Hallen des Tempels der Göttin irgend einem Fremden preisgeben. Zu diesem Zwecke war der Tempel der Göttin mit langen offenen Säulenhallen und Wandelgängen versehen, die dazu dienten, dass der Vorübergehende ganz ohne jede Behinderung eine der darinnen wandelnden Frauen für sich aussuchen konnte. Hatte der fremde oder einheimische Wanderer seine Wahl getroffen, so warf derjenige, der er sich ausgesucht hatte, eine Silbermünze in den Schoss, und die Betreffende musste sich nun dem Fremden ohne jeden Widerspruch preisgeben, ganz wie er es verlangen mochte und gleichviel wie hässlich oder abschreckend er
auch sein mochte. Sie durfte auch das Silberstück nicht zurückweisen, das war gesetzlich verboten. Diese so empfangenen Silbermünzen wurden als geheiligt betrachtet und dienten zur Bereicherung der Tempelschätze dieses Ritus. Jede weibliche Person des Landes ohne jede Ausnahme, ob hoch oder niedrig, reich oder arm, ob Frau eines Fürsten oder eines Bauern, musste sich ganz gleichmässig dieser unvermeidlichen Zeremonie der Einweihung in die Mysterien der Mylitta unterziehen. Den einzigen Vorzug, den reiche und hochgestellte Frauen sich verschaffen konnten, war der, dass alle, die eine zahlreiche Dienerschaft besassen oder zu dem Zwecke sich anschaffen konnten, die ganze Dienerschaft bis zu den Toren des Tempels mitnehmen konnten, und sie selbst innerhalb derselben in Wagen warten durften, bis ein Fremder gewählt haben mochte. Durch den Aufwand zahlreicher Dienerschaft in der Nähe des Wagens hoffte manche Dame edler Herkunft oder von hohem Range, Männer niederen Ranges und Standes möglicherweise fernzuhalten, selbe gewissermassen einzuschüchtern, so dass sie wenigstens nur Männern ihres eigenen Standes und Ranges sich hinzugeben hätte. Immer gelang diese List natürlich auch nicht. Es wird im Gegenteil berichtet, dass gerade dieser Aufwand von Dienerschaft, also äusserliche Beurkundung hohen Standes, oder grossen Reichtum, unerwünschte »Moments-Freier« anzog, und zur Werfung der Münze veranlasste!
Sexualopfer gleicher oder ähnlicher Art wurden auch in Indien zur Zeit der Frühjahrs- und Herbst-Äquinoktien dargebracht.
Die sämtlichen bekannten Modifikationen des Paganismus in allen Teilen der Erde stammen aus einer gemeinsamen Urquelle. Zeit und Ort dieser Urquelle lassen sich aber nicht bestimmen. Was darüber geschrieben wird, ist nur Spekulation. Der intensivste Wunsch des Orientalen (unter Orientale ist hier nicht nur der Eingeborene Asiens, sondern auch der Afrikas, insbesondere die Ägypter und deren Kulturvorgänger zu verstehen) war die Sicherung der Nachkommenschaft und Gründung einer an Kopfzahl reichen Familie. Es liegt daher ganz nahe, dass er infolge dieses intensiven Wunsches zur Verehrung desjenigen Organs kam, durch dessen Kraft allein sein Wunsch erfüllt werden konnte. Das Organ wurde ihm ein heiliger Gegenstand, dem man göttliche Anbetung schuldig wurde; und so entstand der Phalluskultus, dem ganz gewiss jeder unreine Gedanke fern lag. In seinen Uranfängen war der strenge, heilige Ernst dieses Dienstes durch keine Frivolität und keine lasterhaften Auswüchse und Missbräuche verfälscht und geschändet.
Dieser Wunsch der Sicherung möglichst zahlreicher Nachkommenschaft findet heute noch in Dahomé in einem Phalluskultus rohester Form seinen Ausdruck.
Jede Strasse von Whydah bis zur Landeshauptstadt ist dekoriert mit dem Symbol der Zeugungskraft. Diese Dahomé-Phalli sind aus Ton gemachte Figuren, die in Grösse von der eines übernatürlichen Riesen bis herunter zu der eines Zwerges variieren und aus deren Leibesmitte übertriebene grosse, und ausser allem Verhältnis zur Grösse der Figur stehende, Zeugungsorgane horizontal hervorstehen. Manche dieser »Lebensbäume« erreichen fast die Stärke und
Länge von Gartenpfählen und sind mit Palmöl eingeschmiert. Die Frau, welche Mutter werden will, besorgt die Ölung des Gliedes und erfleht dabei vom Gott Legba Nachkommenschaft. Weibliche Legbas (Figuren mit Darstellungen des weiblichen Reproduktions-Organes) sind seltener als die männlichen Legbas. Ein englischer Forscher konstatierte vor ungefähr fünfzehn Jahren, dass auf zwölf Phallusfiguren immer erst eine Figur mit Darstellung des weiblichen Organs kam. Auch diese zeichnen sich durch unmässige Grösse des Organs aus und werden ebenfalls bei der Anbetung geölt. Indem wir uns von dieser rohesten Form des Phalluskultus abwenden, wollen wir noch Voltaire zitieren, der sagte: Es ist unmöglich, annehmen zu wollen, dass zügellose und ausschweifende Sitten ein Volk zur Begründung von religiösen Zeremonien führen konnte. Man muss vielmehr zugeben, dass der Grundgedanke der war, einer Gottheit Ehren und Opfer darzubringen unter dem Symbol des lebenzeugenden Organs, und dass dieser Kultus zur Zeit der einfachsten und reinsten Sitten entstanden ist. Dass der Ursprung des Phalluskultus ein reiner und aus naivem, einfachem Gemüt hervorgegangener war, das steht ohne Zweifel fest. Es war eben nichts anderes als eine allegorische Verehrung der mystischen Vereinigung zwischen Männlich und Weiblich, die durch die ganze Natur als die einzige Möglichkeit der Erhaltung und Fortpflanzung des Lebens sich dokumentiert.
Obgleich also der Ursprung des Kultus ein reiner war, so muss doch zugegeben werden, dass in späteren Zeiten schwere Auswüchse denselben befleckten. In Rom nahmen die durch den Kultus hervor-
gerufenen Exzesse eine derartige Ausdehnung und solche verabscheuungswürdige Formen an, dass der Senat eingreifen musste, um dem zum öffentlichen Skandal gewordenen Kultus Einhalt zu tun. Die Rasereien der bacchanalischen Feste wurden unterdrückt, und die Feste selbst beziehungsweise deren phallische Zeremonien wurden ganz wesentlich modifiziert.
Diese und ähnliche Auswüchse und Missbräuche, die der Phalluskultus nicht nur in Rom, sondern auch in anderen Ländern mit sich brachte und im Gefolge hatte, führten dazu, dass die Priester der verschiedenen Länder den Kultus in eine mystische Hülle kleideten. Man begann die Zeugungskraft unter anderen Symbolen zu verehren. Man verbarg Phallus, Linga, Yoni etc. unter Hieroglyphen, rätselhaften Zeichen und zuletzt unter dem Symbol der Jungfrau Maria mit dem Kinde. Diejenigen, welche diesem Gegenstand ein eingehendes Studium widmen, werden sehr stark überrascht sein, zu finden, dass Anzeichen, Überreste, Monumente, dekorative Spuren, Symbolik u. s. w. von ehemals gewesenem, oder noch bestehendem, Phalluskultus in allen Ländern, in denen überhaupt irgend ein religiöses Empfinden zu einem Religionskultus geführt hat, vorhanden sind, und göttliche Verehrung der Schöpfungskraft in jeder Religion nachgewiesen werden kann.
Man braucht durchaus nicht einer zügellosen Phantasie die Führung zu überlassen, um in Tausenden von Orten und an Tausenden von Gegenständen in unserem christlichen Europa dekorative oder zeichnerische Anzeichen des Phalluskultus zu finden. Selbst an den Geräten, Einrichtungen, Möbeln unserer christlichen Kirchen etc. finden wir derartige
Anklänge. Wir werden im Verlaufe dieses Werkes Gelegenheit haben, näher darauf einzugehen, und Beweise dafür liefern zu können. In überreichlicher Zahl werden wir selbe aber nachweisen in Spanien, Griechenland, Ägypten, Indien und selbst in den teutonischen Ländern, besonders bei den Anglo-Saxonen und Skandinaviern. Als eine Verirrung und Degradierung der ursprünglich reinen Idee der Verehrung der göttlichen Schöpferkraft in den menschlichen Zeugungsorganen muss man es aber allerdings betrachten, wenn man findet, dass es Gegenden gibt, in denen noch heute der Eingang zu einer Höhle, der Spalt in einem Felsen, die ikonische Auswachsung eines Meeresgestades durch die brandende Flut, eine in das Meer hineinragende Landzunge, ja sogar die menschliche Zunge, in gewisser Form aus dem Munde hervorragend, als symbolische Darstellungen der menschlichen Zeugungsorgane allein oder als miteinander verbunden betrachtet werden!
Ein Spalt in einem kühn ins Meer hinausragenden Felsen, genannt Malabar Point, wird als berühmtes Yoni verehrt, und das Passieren durch diesen Spalt galt seit undenklichen Zeiten, und gilt heute noch als ein Regenerationsprozess!
Selbst in Grossbritannien findet man noch heute einen derartigen Aberglauben verbreitet, besonders in Cornwall. Um Kinder von Krankheiten zu befreien, wurden und werden selbe an gewissen Orten durch frisch gespaltene Bäume gezogen. In der Gemeinde Mardon befindet sich ein Stein mit einem Loch, das vierzehn Zoll im Durchmesser hat, durch welches viele Personen sich zwängen, um von Schmer-
zen im Rücken und in den Lendengegenden geheilt zu werden. Auch Kinder zieht man durch das Loch, wenn selbe von der sogenannten englischen Krankheit befreit werden sollen.
Einen derartigen Vorgang, der sich im Jahre 1888 in England zugetragen hat, findet man z. B. sogar im Londoner Standard, Ausgabe Monat September 1888, genau beschrieben. Ein anderer Korrespondent derselben Zeitung konstatiert, dass ihm ein gleicher Vorgang in den fünfziger Jahren in Rio Janeiro bekannt geworden sei. In den siebziger Jahren war dieser Gebrauch in Suffolk (England) sogar noch ziemlich verbreitet. Im Vergleich zu Indien blieb dieser Gebrauch in England jedoch keinerlei religiöser Charakter mehr an. Über den Vorgang selbst findet man bei verschiedenen Forschern genaue Angaben. Meistens wurden junge Bäume ausgewählt, in den besonders verzeichneten Fällen war es immer eine Esche, die man der Länge nach fünf Fuss weit aufspaltete. Dieser Spalt wurde von einem Manne offen gehalten, während der Vater des kranken Kindes dasselbe entkleidete und dann mit dem Kopfe voran durch den Spalt zog. Sowie dieser Akt vorüber war, wurde der Baum verbunden, und in derselben Zeit, in der die Wunde des Baumes vernarbte, musste das Kind von seiner Krankheit genesen, was auch der Fall war. Ein gleiches Vorkommnis wird aus Woodbridge berichtet. Auch dort konnte man eine junge Esche sehen mit einem bereits vernarbten Spalt, durch den ein Kind, das an einem Bruch gelitten hatte, gezogen und von seinem Leiden geheilt worden war. (Fortsetzung folgt.)
KAPITEL II.
Phallismus in den verschiedenen Ländern. Khem oder Cham in Ägypten. Verrohung des Kultus in Ägypten. Der Phallus-Schwur. Gebräuche in Wales. Das Zwitter-Element. Charakter des Phallus. Phallus-Symbole der Gegenwart. Herodot und die Bacchanalien. Priapus in Rom und Griechenland. Maachah, ein Priapus-Verehrer. Belphegor. Auswüchse des Priapusdienstes. Herkunft des römischen Priapus aus Ägypten. Catullus über Priapusdienst. Formen des Priapusdienstes. Phallismus im allgemeinen. St. Augustinus. St. Fontin und Priapus. Phallismus in Frankreich. Neapolitanische Feste. Der Maibaum in Indien und Europa.Der Phallismus variiert zwar in Einzelheiten in den verschiedenen Ländern, aber überall hat er dieselbe gemeinsame Quelle und den gleichen Grundcharakter. Der Akt oder die Idee, deren Symbol oder bildliche Verkörperung der Phallus war, wurde dargestellt von einer Gottheit, der er geweiht war, und in den verschiedenen Ländern respektive bei den verschiedenen Völkern hatte diese Gottheit verschiedene Namen.
In Ägypten finden wir, dass Cham oder Khem als Repräsentant des Zeugungsprinzipes die gleiche Bedeutung hat wie in Griechenland Pan. Infolge
seiner Eigenschaft als Gott des Hervorbringens und der Zeugung wurde Khem von den Ägyptern als die Gottheit betrachtet und verehrt, der man nicht nur die Hervorbringung alles Lebens im allgemeinen, sondern insbesondere die Erhaltung der eigenen Rasse und Familie durch Gewährung reicher Nachkommenschaft verdankte. Man findet daher auch in den heiligen Skulpturen der ägyptischen Tempel emblematische Darstellungen, wie ein König in der Gegenwart des Gottes mit einer Hacke der Erde aufhaut, um selbe anscheinend dem befruchtenden Einflusse des Gottes zugänglich zu machen. Diese allegorische Darstellung genoss die Gottheit sowohl in der Eigenschaft als Gott Cham oder Khem, wie unter dem Namen Amunra, der Erzeuger. Der Eigenschaft der Zeugungskraft der Gottheit entsprang bei den Griechen und Römern zweifelsohne auch der Gebrauch, ihre Gärten unter den Schutz des Priapus zu stellen. Die abstrakte Idee des Zeugungs-Einflusses nahm späterhin rohe und sinnlich ausschweifende Formen an.
Die Verehrung, die Khem oder Cham bei den Ägyptern genoss, war so gross, dass man sein Bild und seine Statue nicht nur in allen Tempeln vorfindet, sondern man baute sogar eine Stadt in Thebides und nannte selbe zu Ehren des Gottes Chammin, Khemmin oder Cham, was so viel bedeutet als Pan’s Stadt.
Bei den Ägyptern hatte der Phallusdient einen Zug relativer Reinheit und zeichnete sich durch eine Art naiven Idealismus aus, den er in anderen Ländern überhaupt nie, nicht einmal in den allerreinsten Uranfängen hatte, und den man in den meisten Ländern auch für ganz unangebracht hielt.
Die Ägypter beschränkten sich z. B. darauf, nur die männlichen Reproduktionsorgane an ihren Götterstatuen und in ihren Tempeln darzustellen. Diese phallische Nachbildungen waren ja wohl plump, aber jedenfalls wirksam und überzeugend in dem Sinne, den die Ägypter diesen bildlichen Darstellungen der Zeugungskraft beilegten. Man kann, in diesem Sinne betrachtet, keine wirksamere Symbolik finden, als wie in den Gottheiten Ammon, Ptah und Osiris die Eigenschaften der Zeugung und des Wachsens, und der ithyphallische Charakter derselben dargestellt wurden.
Im ersten Kapitel ist schon erwähnt worden, dass in orientalischen Ländern der Gebrauch geherrscht hat und in manchen Gegenden tatsächlich heute noch herrscht, bei Ablegung eines Eides die Hand auf das Zeugungsorgan zu legen, oder vielmehr es in die Hand zu nehmen. Dies geschah ganz besonders dann, wenn der Schwörende dem Eid ganz besondere Heiligkeit und bindende Kraft beilegen wollte. Diese Art des Eides findet man heute noch in Syrien, Mesopotamien und Ägypten u. s. w., es
kommt sogar vor, dass Eingeborene, ohne gerade einen Eid leisten zu wollen, nur um ihren Versicherungen Nachdruck zu geben, bei irgend welchen Beteuerungen ihre Hand auf das Zeugungsorgan legen, oder es mit der Hand berühren. Ein besonders charakteristischer Fall dieser Art wird aus der Zeit der napoleonischen Invasion Ägyptens geschichtlich berichtet.
Ein Ägypter war unter dem Verdacht, ein Spion zu sein, gefangen genommen worden und wurde vor den General Julian gebracht, der ihn verhören liess. Der gefangene Ägypter beteuerte mit grosser Lebhaftigkeit seine Unschuld, und als er fand, dass man ihm nicht glauben wollte, zerriss er seine Bekleidung, entblösste die untere Hälfte des Körpers, und indem er nach seinem Reproduktionsorgan griff und selbes festhielt, legte er höchst dramatisch einen schweren, feierlichen Eid ab, worin er beteuerte bei seinem Heiligsten, dass er nicht der Spion sei, für den die Franzosen ihn hielten.
Englische Altertumsforscher erklären, dass ein ähnlicher Gebrauch auch im nördlichen Europa vorhanden gewesen sei, und dass in Wales noch heute ein Gesetz vorhanden ist, das die Existenz dieses Gebrauches beweist. Dieses Gesetz stammt aus der Zeit Hoel des Guten und behandelte die Straftat der Notzucht. Es bestimmte, wenn eine Frau, der ein Mann gewaltsam und gegen ihren
Willen geschlechtlich beigewohnt hatte, wollte, dass ihr Gerechtigkeit widerfahre und der Missetäter bestraft werde, müsse sie die Identität des Mannes, der sie vergewaltigt habe, beschwören, und bei Ablegung dieses Eides, von dem die Bestrafung des Vergewaltigers abhing, müsse sie ihre rechte Hand auf die Reliquie des National-Heiligen legen und mit ihrer linken Hand das Zeugungsglied des angeschuldigten Mannes fassen.
Caylus weist das Alter dieses Gebrauches nach, und beweist durch Reproduktion eines Bildes, das den Osiris darstellt, wie er bei Ablegung eines Eides seinen Phallus ergriff, dass er schon bei den alten Ägyptern bestand. Je sorgfältiger man die Religions-Systeme der Alten studiert, desto klarer wird es dem Forscher, dass Geschlechts-Kultus die Basis von allen Religionen war. Das Zwitter-Element in den Religionen ist auch Geschlechts-Anbetung. Die Gottheiten wurden »Er-Sie« genannt und als Figuren halb Mann, halb Weib dargestellt. Synesius gibt eine ägyptische Inschrift wieder, die unter der bildlichen Darstellung einer ägyptischen Gottheit stand und lautete: »Du bist der Vater — und du bist die Mutter —, du bist der Mann, und du bist die Frau.«
Über die Entstehung der »Zwitter« (herm- aphroditische Personen, abgeleitet von Hermes und Aphrodite) ist folgende Sage bekannt. Ein Sohn
des Merkur (Hermes) und der Venus (Aphrodite) liebte die Nymphe Salmacis, indem er nun seine Geliebte in heisser Liebe umging, flehte er die Götter an, sie möchten beide zu einer Person verschmelzen. Dieses Gebet fand Erhörung und so entstand die herm-aphroditische Form oder deutsch der Zwitter.
In dem Phalluskultus der ägyptischen Religion bieten sich uns zwei Ideen dar, die nominell ein Ganzes bilden. Die Phallusanbetung ist einerseits eine Verehrung, Anbetung der schöpferischen und zeugenden Kraft der Gottheit, andererseits aber die Symbolisierung der Entstehung von Leben aus Tod, die Erneuerung alles Lebenden nach dem Tode in anderer Form, das heisst, es war ein Symbol der Unsterblichkeit, der Auferstehung vom Tode. In diesem letzteren Sinne wurde der Phallus auf die Särge der Alten gemalt und auf die Grabsteine eingegraben. Er sollte den Hinterbliebenen sowohl wie dem Fremden, der am Grabe Halt machte, um des Verstorbenen zu gedenken, die Tatsache der Unsterblichkeit eindringlichst ins Gedächtnis rufen, und die Auferstehung das Wiederlebendwerden des Verstorbenen wirksamst andeuten. Mariette Bey sagt: Diese Phallusbilder hatten absolut keinen unsittlichen, obszönen Beigeschmack, sie waren tatsächlich nichts anderes als die wirksamste und dem einfachsten Gemüte einleuchtendste Darstellung der
himmlischen Schöpferkraft, der Unsterblichkeit alles Lebenden, wodurch auch dem einzelnen Menschen eben das Wiedererstehen aus dem Tode, das ewige Weiterleben zur Gewissheit wurde. Man hat ja den Schöpfer auch durch andere Bilder dargestellt. Man hat z. B. den Schöpfer als Töpfer an der Drehscheibe personifiziert. Es kann doch gar keinem Zweifel unterliegen, dass ein derartiges Bild durchaus nicht so wirksamen oder dauernden Eindruck von der schöpferischen, zeugenden und alles erhaltenden Gotteskraft im menschlichen Herzen erwecken kann und hinter Menschen als die eigne Quelle der schöpferischen und zeugenden Kraft das heiligste und wertvollste Besitztum ist. Es wäre durchaus nur zu wünschen, dass auch unsere Zeit den Phallus resp. die menschlichen Reproduktionsorgane wieder als etwas »Heiliges«, statt als etwas »Satanisches, Sündhaftes und Unsittliches« betrachten würde. Unsere Zeit würde dadurch nur an »Sittlichkeit« gewinnen, aber gewiss nicht verlieren.
Befremden wird es die meisten Leser, wenn sie hören, dass selbst an den hehrsten christlichen Kathedralen unserer Tage die Wahrzeichen eines ehemaligen Phallusdientes übrig geblieben sind! Doch ist es eine nicht wegzuleugnende Tatsache, dass die Türme unserer Kirchen, ganz besonders
gewisse Formen derselben, nichts anderes sind als ehemalige Verkörperungen des Phallus, wie sogar gewisse Kirchen und Kathedralen in der Art ihrer Anlagen gewaltige Nachbildungen von Lingam-Yoni (die monumentale Darstellung der Vereinigung der männlichen und weiblichen Reproduktionsorgane) sind! Der Archäologe kann das nur bestätigen.
Bonwick sagt: »Dem poetischen Gemüte des Hindu ist diese Bedeutung des Turmes unserer Kirchen vollständig auf der Hand liegend, er könnte gar keine andere für verständlich halten, unseren Frommen in London ist sie aber jedenfalls ebenso gewiss unverständlich und shocking (anstössig). Wir bewahren aber sogar auch in unseren Kirchen, und zwar auch auf dem Altar Reminiszenzen des ehemaligen Phallusdientes. Wir bewahren in unseren Kirchen Symbole, die jedem Orientalen ein verschmitztes Lächeln entlocken und ihn zu der Frage veranlassen, warum wir denn Missionare nach Indien senden, während wir doch, wie ganz offenkundig durch die Symbole bewiesen wird, seinem alten Glau ben in unserem Glauben anhängen und selbem weiter pflegen.«
Bezüglich des Phallusdientes in Ägypten schreibt Herodot: Am Vorabende des Bacchusfestes opferte jeder Ägypter vor der Türe seines Hauses ein Schwein, das nachher dem Schweinehüter zurückgegeben wurde, der es davontag. Im übrigen
wurde das Fest aber genau so wie in Griechenland gefeiert, nur dass die Ägypter keine Chor-Tänze aufführten. Zu diesen mystischen Festen (Orgien) wurden von den Griechen kleine, obszöne Nach bildungen der Pudenda hergestellt (eine Elle gross), welche so künstlich ausgeführt waren, dass man die Nervenstränge erkennen und das Organ bewegen konnte. Diese Nachbildungen wurden von den Frauen in feierlicher Prozession umhergetragen, die Pudenda dabei von der Trägerin in Bewegung ge halten, und zu den Tönen einer Flöte sangen und tanzten sie dem Gotte Bacchus Lob und Preis! Herodot sagt, dass Melampus diese Feste und Opfer, sowie den Pomp des Phallusdientes und alle damit zusammenhängenden Zeremonien der Ägypter zu Ehren Bacchus zuerst bei den Griechen eingeführt habe. Aristoteles führt die Entstehung der alten Satyrn auf die Zotenreisserei und die improvisierten rohen Witze, die bei diesen Festen üblich waren, zurück. In Rom, Griechenland und gewissen Teilen Italiens nahm der Phallusdient die Form der Priapus-Anbetung und Verehrung an.
Priapos war, nach einer griechischen Sage, ein Sohn des Dionysos und der Aphrodite oder einer Nymphe. Er wurde von altersher zu Lampsakos am Hellespont als ein Gott verehrt, der die Herden, Gärten, Weinberge fruchtbar machte, und er genoss besondere Anbetung seitens der jungen Ehefrauen
und jungen Mädchen, welche vor der Hochzeit stan den, wegen der ausserordentlichen Grösse seiner Reproduktionsorgane. Durch diese Grösse sollte die grosse Reproduktionskraft des Gottes eben bild lich dargestellt zum Ausdruck kommen. Mit Priapus bezeichnete man denn auch die männlichen Zeugungsorgane, den Penis und den Hoden.
Es wird berichtet, Maachah, die Königin und Mutter von Asa, habe zu Ehren des Priapus einen Hain geschaffen, selben dem Dienste des Priapus geweiht und den Opfern zu Ehren des Gottes im Hain selbst präsidiert. Das I. Buch der Könige, 15, und II. Buch Chronik, 14 berichten, dass Asa um deswillen seine Mutter vom Throne gestossen habe, die Götzenbilder zerstört und den Hain niederhauen habe lassen.
Man nimmt auch an, dass Priapus mit Belphegor identisch gewesen sei. Belphegor wird vom heiligen Hieronimus als ein schändliches Götzenbild genannt. Eine andere Sage aus römischer Quelle erweitert die Geschichte des Priapus. Juno soll auf Venus (Aphrodite) über die Empfängnis des Priapus, als dem Sohne des Bacchus (Dionysos), äusserst eifersüchtig gewesen sein, und soll durch Zauberkünste es verursacht haben, dass Priapus mit unförmlichen und ausser allen Verhältnissen zu seiner Grösse stehenden Zeugungsorganen zur Welt kam. Deshalb verbannte Venus den Priapus nach Lampsacus, woselbst er
erzogen werden sollte. Er wurde jedoch ortselbst der Schrecken aller Ehemänner, so dass vor deren Zorn er fliehen musste. Nach seiner Flucht befiel aber die Männer von Lampsacus eine gewisse heimliche Krankheit in ihren Reproduktionsorganen, und da sie diese Krankheit als eine Rache des verjagten Priapus betrachteten, riefen sie ihn zurück, bauten ihm einen Tempel und zollten ihm und besonders seinem Organ göttliche Verehrung. Die Auswüchse, welche diesen Festen zu Ehren des Priapus anhafteten, lassen sich nicht andeutungsweise beschreiben. Boissart hat die Reproduktion eines Basreliefs veröffentlicht, welches die mehr als schamlosen Gebrauche bei diesen Festen erkennen lässt. Die denkbar widrigste und unnatürlichste Wollust und Trunkenheit kam dabei öffentlich zum Ausbruch und liess die Menschen im ekelhaftesten Schmutze sich wälzen. Der heilige Augustin gibt eine Beschreibung der Orgien. Auszugsweise berichtet Banier folgen des: Die Römer scheinen die Verehrung des Priapus von den Ägyptern übernommen zu haben, die unter der Form des heiligen Stiers, Apis, die zeugende Kraft der Natur verehrten. Da die Silbe pri oder pre in der orientalischen Sprache Prinzip, Grund ursache, Erzeugung bedeutet, so mag das Wort Priapus als gleichbedeutend mit Prinzip der Pro duktion oder Fecundation des Apis gedeutet wer den. Dieselbe Bedeutung hatten bei den Römern
die Namen Tutunus, Mutinus, Fascinum. Das letzte re Wort bedeutet einen Schutz (Zauberformel) gegen böse Geister (Einflüsse), wurde über Türen und Tore angebracht (wie heutzutage das Hufeisen) und von Kindern als Amulet um den Hals getragen. Kinderlose Frauen trugen es in der Hoffnung, mit Kindern noch gesegnet zu werden. Zu gleichen Zwecken wurden von kinderlosen Frauen auch kleine Votiv-Opfer aus Porzellan, Bronze, Holz in den be treffenden Tempeln dargebracht. Man fand eine grosse Anzahl derselben in Herculaneum, Pompeji und in ägyptischen Gräbern.
Die bildnischen Darstellungen des Gottes Pria pus variierten natürlich in Einzelheiten in den verschiedenen Gegenden, der Hauptcharakter war aber immer derselbe. Allen gemeinsam war, dass die Figur sich durch einen über alle Massen und ausser allem Verhältnis zur Grösse der ganzen Figur stehen den grossen Phallus auszeichnete. Manche hatten einen menschlichen Kopf mit Ohren und Hörnern eines Ziegenbockes, manche hatten den Kopf eines Rehes, manchmal bestand die Darstellung nur aus einem Kopf mit kleiner Büste und einem riesigen, hervorstehenden Phallus. Ein Forscher gibt an, dass er bei einem Kardinal eine derartige Büste gesehen habe, deren Phallus als Wegweiser einst gedient hatte. Priapus wurde auch dargestellt mit einer Hand, eine Sichel haltend und mit der anderen das mäch
tige Glied fassend. Es war ein allgemeiner Gebrauch, dass Frauen und Mädchen das von Kraft strotzende Glied mit Guirlanden schmückten und Kränze daran aufhingen. Der heilige Augustin erklärt, dass es bei den ehrbarsten Frauen und Mädchen Roms üblich war, sich auf das stramm hervorstebende männliche Zeugungsorgan zu setzen. Dieser Akt war sogar eine fromme Handlung und wurde besonders von Bräuten mit grosser Andacht vollzogen. Lactantius erwähnt diesen Gebrauch bei den römischen Mädchen und Bräuten, giebt demselben aber eine etwas verfängliche Deutung. Er sagt, die Bräute übten diesen Aktus mit dem Phallus des Priapus aus, um den Anschein und Eindruck zu erwecken, als ob der Gott der erste gewesen sei, dem sie das Opfer ihrer Unschuld gebracht hätten! Er spricht auch von Jutinus, vor dem »die Bräute sitzen«, als eine Einleitung zu den »Hochzeitsriten«. Ferner stellt er fest, dass an manchen Orten ein formloser, unbehauener Stein unter dem Namen Terminus dieselbe Verehrung genoss, wie der Phallus des Priapus. Gleiche Verehrung wie Pan und Dionysos bei den Griechen, Cham und Osiris bei den Ägyptern, Schiwa bei den Hindu, Adonis bei den Phöniziern, genoss Vul bei den Assyrern, Fricco bei den Skandinaviern, Hortanes bei den Spaniern, Attys bei den Phrygiern.
Der heilige Augustin erzählt, dass infolge des
Übermasses der Exzesse bei den Festen zu Ehren des Phallus die Behörden diese Feste schliesslich unterdrücken mussten. Bei den Festen der Venus verehrten die Matronen Roms das geweihte und heilige Emblem im Tempel auf dem Quirinal, trugen es in feierlicher Prozession nach dem Sanctuarium der Venus Erycina, woselbst es der Göttin dargebracht und dann in gleichem feierlichem Aufzuge nach dem Quirinal zurückgetragen wurde. Zur Frühjahrszeit trugen die römischen Landleute einen Phallus über ihre Felder, um dadurch den Fruchtbarkeit zu erlangen. In Mexiko, Zentral-Amerika und Peru haben die ersten Eroberer nicht nur Kreuze nach Art der christlichen Kreuze, sondern auch eine Unmasse phallischer Symbole gefunden. In Panuco wurde in den Tempeln der Phallus verehrt, und in Tlascalla genoss sowohl der Phallus wie die Cteis göttliche Anbetung. Basreliefs schmückten die öffentlichen Plätze, auf denen, nach Art des Lingam-Yoni der Hindu, die Vereinigung der beiden Geschlechtsorgane bildnerisch dargestellt und verherrlicht wurde.
In Cuzco, am Eingang zum grossen Tempel, und in Yuketan in den Tempeln, stunden grosse phallische Säulen, ferner monumentale Strukturen, deren Zweck in der Urzeit des Altertums verborgen liegt. Die runden Türme und Druidensteine in Irland sollen gleichen, oder ähnlichen Zwecken ge-
dient haben. Diese mysterösen runden Türme in Irland werden von den unterrichteten Forschern als phallische Symbole bezeichnet, die noch aus der grauen Urzeit stammen, als durch Eingeborene Indiens eine teilweise Kolonisation der irischen Insel stattfand und selbe, gemäss ihrem heimischen Kultus, der Zeugungs- und Reproduktionskraft göttliche Verehrung geniessende bildnerische Symbole errichteten.
Wir finden auch in Frankreich Gegenden, in denen eine Art Phallusdient heimisch war. Der erste Bischof von Lyon wurde in den Provinzen Languedoc, Provence u. s. w. als ein Heiliger verehrt. Sein Name war Pothin, Photin, Fontin oder Fotin. Das Volk sprach den Namen Foutin aus, und infolge der Ähnlichkeit in der Aussprache des Namens mit einem anderen Worte identifizierte das Volk St. Foutin mit dem anderen Worte, und hielten ihn für würdig, St. Priapus, den Gott ihres ehemaligen Religionskultus, zu ersetzen. So kam es, dass St. Foutin als Fortsetzung des ehemaligen Phallusdienstes gemissbraucht wurde. Bestärkt wurde dieser Gebrauch durch den Umstand, dass St. Foutin den Ruf genoss, er könne kinderlose Frauen fruchtbar und impotente Ehemänner kraftvoll machen, sowie geheime Krankheiten heilen. Es war deshalb in jenen Provinzen Sitte geworden, dass man nach Art der Votivopfer, die man dem Priapus dargebracht
hatte, Nachbildungen der männlichen oder weiblichen Zeugungsorgane aus Wachs anfertigte und selbe unter bestimmten Zeremonien und Gebeten auf dem dem heiligen Foutin geweihten Altare niederlegte. Sanci sagt, dass die Kapelle des heiligen Foutin mit Nachbildungen der pudenda beider Geschlechter vollständig besät war. Als im Jahre 1581 die Protestanten die Stadt Embrun besetzten, fanden sie unter den Reliquien der Hauptkirche der Stadt den Phallus von St. Foutin. Die frommen Leute jener Stadt brachten diesem Phallus Weinopfer dar. Die Frauen gossen Rotwein über die Extremität des Phallus, der von diesem Gebrauch an der Spitze vollständig rot gefärbt erschien, und sammelten den so darüber gegossenen Wein wieder in einem Gefässe, in dem sie den Wein sauer werden liessen, um ihn dann später zu einem besonderen (Sexual-) Zwecke zu verwenden.
Es wird auch berichtet, dass in manchen Gegenden Frankreichs bei Frauen der Landbevölkerung der Gebrauch herrschte, von einer hölzernen Nachbildung des Phallus des heiligen Foutin Holz abzuschaben, das Geschabte mit Wasser zu mischen und dann zu trinken, als eine Art Zaubertrank, um Kindersegen herbeizuführen.
Es wird ferner berichtet, dass in der Kapelle von St. Guingalais in der Nähe von Brest ein hölzernes Standbild des Heiligen war, das als Phallus
einen runden Holzbalken besass, der durch die ganze Figur hindurch ging. Auch hier herrschte die oben beschriebene Sitte. Die kinderlos gebliebenen Frauen verschluckten das abgeschabte Holz mit und ohne Wasser. Es wird nun von den Skeptikern der Gegend behauptet, dass die Priester von Zeit zu Zeit den hölzernen Phallus durch einen Schlag von hinten nach vorwärts trieben, um so den Anschein zu erwecken, als ob trotz des fortgesetzten Abschabens der Phallus doch niemals kürzer werde, wodurch der Heilige seine Wunderkraft bewies. Derartige Praktiken scheinen in vielen Gegenden im Schwange gewesen zu sein. Anfangs des siebzehnten Jahrhunderts existierte zu Orange ein aussergewöhnlich grosser Phallus aus Holz mit Leder überzogen und Testen versehen, dem göttliche Verehrung gezollt wurde. Als die Protestanten die Stadt eingenommen und die Kirche von St. Eutropius zerstört hatten, wurde dieser Phallus auf dem Marktplatz der Stadt öffentlich verbrannt.
Bis zum Jahre 1700 war es in Neapel während des Karnevals üblich, dass eine hölzerne Statue des Priapus, dessen Zeugungsglied so gross war, dass es dem Götzen bis unter das Kinn reichte, in öffentlicher Prozession umhergetragen wurde. Dieser Gebrauch wurde später vom Erzbischof Davanzati unterdrückt. Sir William Hamilton berichtet über folgende Gebräuche im ehemaligen Königreich Neapel. »Am
September wird zu Isernia in der Provinz Contado di Molise alljährlich ein öffentlicher Markt (Kirchweih-Messe) abgehalten, der drei Tage dauert. An einem dieser Tage werden die Reliquien des heiligen Cosmo und des heiligen Damianus in der Ortskirche zur öffentlichen Verehrung ausgestellt. In der Stadt und in den Messbuden werden zu derselben Zeit ex-votos aus Wachs feilgeboten, welche die männlichen Zeugungsorgane darstellen. Dieselben haben die verschiedensten Grössen, von der Grösse eines zollgrossen Miniatur-Phallus bis zur Grösse eines Palmzweiges. Es werden auch ex-votos nach Art der Lingam-Yoni (also beide Organe vereinigt) verkauft. Die Verkäufer halten in der einen Hand ein Körbchen mit den ex-votos, und in der anderen Hand einen Teller, worauf man das Geld legen soll, und dabei rufen sie fortwährend: Heilige Cosmos und Damianus! Wenn man die Verkäufer fragt, was die ex-votos kosten, so antworten sie: »più ci metti, più meritti!« (Je mehr du gibst, desto mehr Verdienst erwirbst du dir.) Die Verkäufer sind meistens weiblichen Geschlechtes. Ein Augen- und Ohrenzeuge berichtete, dass eine weibliche Person ein derartiges ex-voto in der Form eines Phallus kaufte, dasselbe zuerst küsste und dann die Worte sprach: »Santo Cosmo, benedetto, così lo voglio!« (Heiliger Cosmo, gesegneter, so soll er sein!) Dabei warf sie dann ein Geldstück auf den Teller.«
Im neunten Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung war die Verwendung einer Nachbildung des Phallus als Amulett so allgemein, dass er von der Kirche in Acht und Bann getan werden musste. Trotzdem aber erhielt sich dieser Gebrauch noch so allgemein im dreizehnten und vierzehnten Jahrhundert nach christlicher Zeit, dass das kirchliche Anathema erneuert werden musste. Und selbst das wiederholte Verbot hat den Gebrauch nicht ganz ausrotten können, denn heute noch hängt man in gewissen Gegenden Italiens den kleinen Kindern Amuletts in der Form von Phalli um den Hals, um sie vor dem »bösen Blick« zu schützen.
Bei den Ausgrabungen in Pompeji fand man, dass vor den Geschäften der Bäcker und den Schmiedewerkstätten als Wahrzeichen an der Tür eine Abbildung des Phallus angebracht war, um böse Mächte abzuhalten und das Glück anzuziehen. Die allgemeine Verbreitung phallischer Embleme in Kleinasien wurde auch durch Schliemanns Ausgrabungen in Troja bewiesen. In einer Tiefe von vierzig Fuss fand derselbe eine Unzahl phallischer Gegenstände.
Ein volkstümlicher Gebrauch verbindet aber unsere heutige Zeit noch mit dem urgrauen Altertum und seinem Phallusdienst. Das ist der Maibaum. Wenn auch der moderne Städter nichts mehr vom Maibaumtanz, Maifest mit dem Dorfmaibaum weiss,
so wird doch in verschiedenen Gegenden Europas, und besonders in vielen Dörfern Englands, noch heute im Mai der Maibaum aufgerichtet zur Feier des Wiedererwachens der zeugenden Naturkraft, des neuen Lebens in der Natur, und dieser Maibaum, der mit Guirlanden geschmückt wird, um den die Jugend in bunter Reihe unter frohen Gesängen herumtanzt, ist nichts anderes als der Phallus einer vergangenen Zeit, das Symbol der zeugenden und schöpferischen Gotteskraft!
Dieser christliche Maibaum hat seinen Stammvater in Indien. Ungefähr um dieselbe Zeit, als nach christlicher Zeitrechnung der erste Mai fällt, feiert man in Indien das Bhavaṇifest, es wird hauptsächlich von solchen Hindus gefeiert, die Rindvieh züchten. Diese Hindus errichteten einen mächtigen Baum (Maibaum) auf ihren Feldern, schmücken denselben mit Bändern und Blumenguirlanden und feiern frohe Feste zu Ehren der Fruchtbarkeit spendenden Gottheit, als deren Organ der Baum über Feld und Wiese errichtet wurde. Wenn auch den christlichen Bewohnern Europas diese phallische Abstammung des christlichen Maibaumes unbekannt geblieben ist, so ist sie doch eine nicht wegzuleugnende Thatsache.
KAPITEL III.
Phallismus in Indien. Phallus-Verehrung in Asien (Syrien). Linga. Die Höhlen von Elephanta. Der Tempel von Hierapolis. Zeremonie von Linga-Puja. Die Frauen und der Lingadienst. Die Hindu und Kindersegen. Hochzeits-Tempel. Minderwertigkeit der kinderlosen Frauen. Schravana und Dasaratha. Die zwölf Lingas. Argha. Stein-Verehrung. Unreine, entweihte Brahmanen. Brahmanen und Feuer. Fehde zwischen Linga- und Yoni-Verehrer. Sarti und Parvati.In keinem Lande der Erde war und ist der Phalluskultus so ausgeprägt wie in Indien. Der gegenwärtige König Eduard von Grossbritannien und Irland, der den Titel führt: Defender of the Faith (Verteidiger des christlichen Glaubens), ist auch gleichzeitig Kaiser von Indien, und als solcher herrscht er, nach Angaben eines englischen Gelehrten, über mehr als hundert Millionen reine Phallusanbeter, also über ungefähr dreimal soviel Phallusanbeter als die britischen Inseln an Einwohnern zählen. Der englische Gelehrte E. Sellon erklärte vor mehreren Jahren in der anthropologischen Gesellschaft in London, dass es in Indien kaum
einen Tempel gibt, der nicht seinen Lingam hat, und dass in den meisten Fällen dieses Symbol die einzige Form ist, unter welcher die betreffende Gottheit des Sanktauariums angebetet und verehrt wird.
Die Lingamanbetung ist die indische Form des Phalluskultus, und trotz einer gewissen Verschiedenheit in der Form, den Zeremonien und den Symbolen ist der Phalluskultus der Römer und Griechen doch identisch mit dem Lingamkultus der Inder.
Der Linga ist ein glatter, runder, schwarzer Stein, der senkrecht aus einem anders geformten Stein herausragt, beziehungsweise innerhalb desselben schon beginnend, durch denselben hindurchgehend, über diesen zweiten Stein hervorstebt, und dieser zweite Stein ist flach und hat die Form eines an einem Ende abgeschnittenen länglichen Untersetzers einer Tunkschüssel. Manche Forscher vergleichen die Form des zweiten Steines mit einer sogenannten jüdischen Harfe. Die ganze Form ist aber, trotzdem selbe anscheinend aus zwei getrennten Teilen besteht, aus einem ganzen Stück Basalt gemeisselt. Die flache Form, welche man als jüdische Harfe bezeichnete (die konventionelle Form der pudendum muliebre), wird in Indien Argha oder Yoni genannt. Die erstere Form, der senkrecht stehende Teil, ist der Linga, das Abbild des membrum virile. Das Ganze führt die Bezeichnung Lingioni, Lingam-
Yoni, oder wird allgemein kurzweg Lingam genannt. Dieses Symbol der Reproduktions- und Regenerationskraft, beziehungsweise die Darstellung der Vereinigung der beiden Geschlechter, welche es in Wirklichkeit auch bildlich vorstellt, ist das Symbol der göttlichen sacti oder vereinigten aktiven Energien, die zeugende und gebärende Kraft, durch welche die ganze Summe der irdischen Wesen entsteht und besteht. Aus dieser Erkenntnis heraus, und um dieser göttlichen Schöpfungskraft willen, wird dem Symbol göttliche Verehrung und Anbetung gezollt. Der ganze Kultus ist gleichzeitig in tiefste Mystik eingehüllt und von mystischen Gebräuchen umgeben. Das Symbol wird ausser aus Basalt und Stein aus zahlreichen anderen Materialien hergestellt, wie z. B. aus Holz, Metall, Ton u. s. w., und in den verschiedensten Grössen, variierend von der Grösse von kaum einem Zoll bis zur Grösse von einem Meter und mehr. Manchmal sieht man solche von ganz enormer Grösse, wie zum Beispiel in den Höhlen von Elephanta, woselbst man auch den unzweifelhaften und unwiderleglichen Beweis findet dafür, dass die Symbole ebenso alt sind wie der Tempel selbst, denn sie sind gleich wie der Tempel aus dem Stein der Höhle herausgemeisselt. Der Boden, die Decke, die Säulen und die zahlreichen Figuren und Skulpturen sind alle aus dem Granit
der Höhle gemeisselt, geschliffen und ziseliert und werden heute noch als eine der grössten Sehens würdigkeiten der Welt bewundert und angestaunt. Die ungeheure Grösse der konischen Linga-Säulen schliessen die Möglichkeit aus, dass selbe zu einer späteren Zeit in den Tempel erst hineingebracht worden wären, ebenso wenig wie es möglich gewesen wäre, die Kolossal-Statuen von Schiwa und seiner Gemahlin, die hier grösser sind wie irgendeine andere Gottheit, von aussen in den Tempel zu bringen. Die Götter sowie die Linga-Säulen sind im Tempel aus dem Gestein des Felsens gemeisselt worden und dokumentieren dadurch ihr eigenes Alter und das Alter des Kultus, dessen Symbol sie sind. Aus Berichten von Forschern geht hervor, dass in manchen Tempeln die Linga vierzig Fuss hoch sind und fünfundzwanzig Fuss im Umfang messen.
Über noch grössere bildliche Darstellungen von griechischen Phalli gibt ein Bericht Drydens über den Tempel von Hierapolis Auskunft. Derselbe sagt: Zwei grosse Phalli stehen im Torweg und tragen folgende Inschrift: »Ich, Bacchus, widme diese Phalli meiner Stiefmutter Juno.« Die Griechen errichteten dem Bacchus kleine Phalli, welche kleine aus Holz gemachte Männer darstellen, bene nasatos und neu rospasta genannt wurden. Auf der rechten Seite des Tempels ist ein kleiner Mann aus Bronze, dessen
enormes membrum ganz ausser allem Verhältnis zu seiner eigenen Grösse ist. Die Priester des Tempels sind Männer, die sich selbst verstümmelt haben und Frauenkleider tragen. Der Tempel steht auf einem Hügel in der Mitte der heiligen Stadt Hierapolis (in der Nähe des heutigen Aleppo) und ist von einer doppelten Mauer umgeben. Das Haupttor des Tempels liegt gegen Norden und hat einen Umfang von 200 englischen Yards. Innerhalb dieses Torweges stehen die oben erwähnten zwei Phalli, von denen jeder ungefähr 180 Fuss hoch ist. Zweimal im Jahre steigt einer der Priester auf die Spitze der Säulen- Phalli und bleibt sieben Tage und sieben Nächte oben. Das Volk nahm an, dass der Mann dort oben zu den Göttern und mit den Göttern rede, für die Prosperität von ganz Syrien bete, und dass die Götter, dem Symbol nahe, diese Bitten erhörten. Während der sieben Tage durfte der Mann niemals schlafen. Innerhalb der Mauern, welche den Tempel umgaben, wurden Ochsen, Pferde, Adler, Bären und Löwen gehalten, welche gezähmt und den Priestern dienstbar gemacht waren.
Abendländer finden es naturgemäss für eine höchst sonderbare Form, um einer Stiefmutter Verehrung zu zollen. Man muss eben bedenken, dass zu jenen Zeiten das weibliche Geschlecht diesem kraftvollen und verehrungswürdigen Talisman gött liche Anbetung zollte und diese Anbetung und Ver-
ehrung offen und ohne Erröten ausübte. Dryden behauptet aber, dass die Phalli bedeutend älter sind als die Inschrift. Diese Phalli seien Symbole der Urreligion des Landes gewesen, welche nur zwei Gottheiten kannte, Himmel und Erde, Uranus und Gäa der Griechen. Das heisst die zeugende Kraft des Himmels und die gebärende Kraft der Erde, wodurch letztere die Mutter alles irdischen Lebens ist. Die zeugende Kraft des Himmels fand seinen bildlichen Ausdruck in dem Phallus, nicht als Bild des Sexual-Organs, sondern als »Vater des Universums«, und deshalb nahm auch niemand Anstoss an diesen Nachbildungen des männlichen Reproduktions organs. Über die Art, wie die Priester auf diese Phalli hinaufgeklettert sind, wird wie folgt geschrieben: Der Priester bindet sich ein Seil um den Leib und dann legt er das Ende dieses Seiles um den Phallus. Danach setzt er seinen Fuss auf eine kleine Holzsprosse, die in den Phallus eingelassen war und gerade soweit daraus hervorragte, um der Spitze des Fusses einen Halt zu geben. Auf diese Art schiebt sich der Mann von einer Sprosse zur andern, indem er dabei das Seil immer im Verhältnis zu seinem eigenen Emposschieben auf beiden Seiten gleichmässig nachschiebt, nach Art eines Kutschers, der einmal rechts, einmal links die Zügel anzieht und nachlässt beim Dirigieren der Pferde. Diese Art
des Kletterns erinnert an die Art, wie die Eingebo renen Afrikas auf Palmbäume klettern. Wenn der Priester auf der Spitze des Phallus angelangt ist, lässt er ein anderes Seil, das er mitgenommen hatte, zur Erde herunter und zieht mit demselben Holz, Bekleidung, Kochgefässe und was er sonst an Materialien und Lebensmitteln nötig hatte, zu sich hinauf. Er baute sich dann eine Art von Nest, in welchem er die sieben Tage sitzend zubringen musste. Während dieser Zeit kamen dann die Andächtigen, opferten Gold- und Silbermünzen (manche begnügten sich auch damit, Kupfermünzen zu opfern), legten auch andere Gaben am Fusse des Phallus nieder, nannten ihre Namen und gingen dann wieder nach Hause. Ein anderer Priester, der in der Nähe Wache hielt, berichtete die Namen der Opfernden dem auf dem Phallus sitzenden Priester, der nun seinerseits für die Opfernden von der Gottheit den Segen der Fruchtbarkeit für die Familie, das Haus, das Feld, das Haustier u. s. w. erflehte und dabei ein metallisches Instrument anschlug, das einen lauten, schrillen Ton gab.
Doch kehren wir zurück zum indischen Gegen stück des griechischen Phallos. Man findet also in Indien auch Linga von ganz winziger Grösse für den Kultus zu Hause oder den persönlichen Gebrauch. Manche Personen tragen sogar stets ein derartiges kleines Symbol bei sich, und in vielen
Familien wurde täglich ein neues Exemplar aus Ton hergestellt, unter den vorgeschriebenen Gebeten und Zeremonien geweiht und dann entweder auf den häuslichen Altar oder unter einen dem Gotte Schiwa geweihten Baum oder Strauch gestellt, woselbst dann die weiblichen Mitglieder des Haushaltes dem Sym bole göttliche Anbetung zollten. In jedem Dorfe ist ein Tempel, und in jedem Tempel ist ein Linga, gewöhnlich zwei oder drei Fuss hoch, der sich aus einer Art breiten Basis in konischer Form gerade zum Himmel emporhob. Junge Mädchen, die Lieb haber oder Ehemänner zu bekommen wünschen, versammeln sich am frühen Morgen in diesen Tempeln zur Vornahme feierlicher Zeremonien und An betung der Gottheit. Diese Zeremonie wird »Linga- Puja« genannt (siehe die Illustration hinter dem Titelblatte). Sie besteht in folgendem Aktus. Zuerst bespritzen die jungen Mädchen das Symbol mit Wasser aus dem Ganges (nach Art der Besprengung mit dem Weihwasser in katholischen Kirchen), dann dekorieren sie den Linga mit Guirlanden aus Tulva- blumen, gefolgt von Gestikulationen mit den Fingern und dem Hersagen der vorgeschriebenen Beschwörungsformeln, schliesslich reiben sie ihren Unterleib gegen das Symbol und flehen die Gottheit an, sie fruchtbar zu machen.
Es liegt in der Natur dieser Zeremonie, dass selbe leicht sinnlich ausartet und zu Missbräuchen führt.
Die Haustempel, in welchen das Symbol aufgestellt wird, nennt man wie die Tempel im allge meinen »Dewal« oder »Deval«, zusammengezogen aus »Deva«, eine Gottheit, und »havela«, ein Haus, also wörtlich ein Haus Gottes. Im Abendlande führen selbe gewöhnlich die Bezeichnung Pagoda. Der Linga und die Argha sind aus schwarzem Stein mit goldenen Rändern. Der Linga (der aufrecht stehende konische Stein) ist mit mystischen orange farbenen Linien bedeckt und mit kreisrund über ander gelegten Bilva- (Schleimapfel-) Blüten gekrönt. Ein Kranz (oder Perlenschnur nach Art der Rosen kranzschnüre) von drei Schnüren mit weissen und roten Knospen in regelmässigen Abständen hängt von der Spitze des Linga herab und endet bei dem stumpf abgeschnittenen Ende (der Ausflussrinne) der Argha. Der Schleimapfelstrauch (Bilva) ist dem Gotte Mahadeva (grossen Gotte) geweiht, der allein einen Kranz dieser Blüten trägt, welche ihm und keiner anderen Gottheit als Opfergabe dargebracht werden. Fünf Lampen (pancharty) werden in der dem Gotte Schiwa geltenden Zeremonie puja verwendet, manchmal jedoch nur eine Lampe mit fünf Dochten. Die übrige Ausstattung besteht aus einem mit einer Ausgussröhre versehenen Gefäss (jari), das das Weihwasser aus dem heiligen Ganges enthält, um damit die Gottheit zu besprengen, einem Becher (dipa) mit ghie (gereinigter aufgelöster Butter) zur
Speisung der Lampen, einem anderen Becher (novady) mit Wasser, um die Blüten und den Linga zu be- sprengen, und einer Glocke (gaut’ha), die man in gewissen Zwischenräumen läutet, um die bösen Geister zu verscheuchen.
In der Illustration, welche sich vor dem Inhalts- verzeichnis befindet, sieht man eine junge Frau mit übereinander gelegten Beinen auf einem gestickten Teppich vor einem Haustempel sitzen. In einer Hand hält sie einen Rosenkranz von 108 Perlen, und ihre Aufmerksamkeit ist ganz auf die Gottheit konzentriert. Sie ist dargestellt, wie sie durch die übliche gottesdienstliche Handlung sucht, die Gunst und Gnade des Gottes Mahadeva in seinem Charakter als zeugende Kraft zu gewinnen. Ausgedrückt ist dies eben durch den Linga, der hier mit der Argha oder Yoni vereint ist, als dem Symbol des männ- lichen Zeugungsgliedes vereinigt mit dem weiblichen Reproduktionsorgan. Die opfernde Frau fleht zweifelsohne um reichen Kindersegen, denn das Gegenteil, kinderlose Frauen, werden in Indien von beiden Geschlechtern verachtet, und eine kinderlose Ehe wird als eine schwere Heimsuchung und Strafe der Götter betrachtet. Dies wird auch dem Abendländer begreiflich, wenn man sich vergegenwärtigt, dass bei den Hindu der Ahnenkultus herrscht. Nach der Annahme des Hindu hängt seine Seligkeit in einem anderen Leben davon ab, dass seine Kinder nach
seinem Tode gewisse Zeremonien regelmässig erfüllen, die bestimmt sind, die himmlischen Strafen, die ihn nach seinem Tode treffen sollen oder müssten, zu ermässigen oder ganz zu ersparen. Deshalb flehen die Inder Linga an, ihnen Nachkommenschaft zu schenken.
Ehemänner, deren Frauen kinderlos geblieben sind, senden ihre Frauen in die Tempel, um zu Linga zu beten und ihm die vorgeschriebenen Opfer zu bringen, und es wird von der Fama behauptet, dass die Frauen gewöhnlich schon Mittel und Wege zu finden wissen, um das gewünschte Resultat mit nach Hause zu bringen.
Der Hochzeitstempel besteht aus zwei Räumen, der eine Raum ist grösser als der andere, jeder hat Nischen. Zu dem ersten Raum, den man von der Veranda aus erreicht, führen vier Stufen. Die äussere Veranda oder Galerie ist verschieden von den in anderen Tempeln sich findenden Vorräumen. Hier wird selbe von dem hinteren Raum oder Kammer durch eine Mauer getrennt, die sowohl richtige Türen wie Fenster zum Einlassen von Licht hat. Die Länge dieser Veranda ist 64½ Fuss, ihre Höhe 12 Fuss und ihre Breite 8 Fuss. Die Kammer ist 67 Fuss lang, 19 Fuss 8 Zoll breit und 11 Fuss hoch. In diesem Raum sind drei Nischen, von denen zwei je 6 Fuss im Quadrat sind, während die dritte um einen Fuss breiter und länger, aber auch nur 6 Fuss
hoch ist. Einige Meter von dieser Veranda oder Vorhalle entfernt ist eine andere Aushöhlung, welche denselben Namen trägt und derselben Bestimmung dient. Es ist ein grösserer und schönerer Tempel als der Nachbartempel. Er enthält in einer Nische, die 40½ Fuss tief und 38 Fuss breit ist, einen Raum, der 21 Fuss im Quadrat misst. In diesem quadratischen Raum steht ein Linga des Mahadeva. Ausserhalb des Tores sind Kolossal-Figuren, ähnlich dem Dhurma-Linga, sie stellen Chand und Prichand vor. Die Figuren, welche selbe in einer Gruppe umgeben, führen andere Namen wie jene des Dhurma-Linga, sie sind im Verhältnis auch kleiner, aber äusserst sorgfältig ausgeführt. Der Hauptschmuck dieses Raumes sind zwei wunderschöne, eigentümlich geformte Säulen, sowie zwei Pilaster, die den Eingang zur Nische zieren. Die Länge der Halle (exklusive der Nische) ist 111 Fuss und die Breite ist 22½ Fuss. Die Stelle des Raumes, welche durch den Tempel sich verengert, ist mit einem ornamentalen Band geschmückt, das Figuren mit Schleiern um die Mitte der Körper zeigt. Der Brahmine hat besondere Namen (wie Kunschnie Suk) für die dort dargestellten Figuren. In der gewöhnlichen Sprache nannte man sie »Dienerinnen von Kamac«. Dem Forscher Seely bezeichnete ein Brahmine dieselben als »Dames de plaisir«. (Fortsetzung folgt.)
Ein Reisender berichtet, dass der Lingam in einem kleinen Tempel mit Öl und Ocker bedeckt war, und Blumen wurden täglich frisch über seine runde Spitze geschüttet. Vor dem Symbol sind fortgesetzt andächtige Frauen, die der Gottheit Opfer darbringen, mit besonderer Sorgfalt es sauber wa schen und mit wohlriechendem Öl, Blumen u. s. w. schmücken und begiessen, während die beaufsich tigenden Brahminen den Raum auskehren, nachsehen, dass die fünf Ölflammen brennen und von Zeit zu Zeit mit der Glocke läuten.
Die Minderwertigkeit der kinderlosen Frauen wird sehr lebhaft durch nachfolgende volkstümliche Sage erläutert und dargetan.
Dasaratha hatte drei Frauen, aber er blieb kinderlos. Nachdem er eine Reihe von Opfern gebracht und fromme Handlungen vollzogen hatte, ohne erhört zu werden, begab er sich in seiner Verzweiflung in die Wildnis der grossen Wälder, um dort als frommer Einsiedler zu leben. Es ereignete sich nun, dass um die Zeit, als Dasaratha bei einer Quelle auf Wild lauerte, ein Brahmin, der mit seinen bejahrten Eltern auf dem Wege nach einer heiligen Messe (jatra) war, aus der benachbarten Quelle (bahuri) für seine Eltern Wasser zur Stillung deren Durstes schöpfen wollte. Als nun Shravana sich dem Quell näherte, hörte Dasaratha zwar das Rascheln, er konnte aber den Brahminen nicht sehen,
und so Wild vermutend, schoss er in der Richtung des Raschelns seinen Pfeil ab. Als Dasaratha der Richtung des Pfeiles nachlief, um die Beute zu sichern, fand er zu seinem Entsetzen statt des Wildes den von seinem Pfeile zu Tode verwundeten jungen Brahminen. Dasaratha war untröstlich, doch Shravana vergab ihm und bat nur, Dasaratha möge seine Eltern unterrichten, während er ihn selbst ruhig sterben lassen möge. Dasaratha lief, den unglücklichen Eltern den Tod des Sohnes zu berichten, welche in ihrem Schmerze dem Dasaratha ein gleiches Schicksal prophezeiten. In seinem Elend und seinem Kummer, einen Brahminen getötet und das Ende der untröstlichen Eltern, die, als sie sich kinderlos sahen, rasch dahinsiechten, verursacht zu haben, schreckte ihn die Prophezeiung der alten Leute gar nicht, im Gegenteil, er erklärte, gerne sterben zu wollen, wenn es ihm vor seinem Tode nur vergönnt wäre, seinem eigenen Sohne noch ins Antlitz sehen zu können. Da er sich gar keinen Rat mehr wusste, ging er schliesslich zu einem gelehrten Guru namens Vasischtha, legte diesem seinen Fall dar, und dieser wies Dasaratha an, wie er die Beerdigungs-Riten vornehmen solle, und welche Opfer notwendig wären, um die ungeheure Sünde, einen Brahminen erschlagen zu haben, zu sühnen. Diese Vorschriften wurden alle genau erfüllt und ausserdem reichliche Gaben an die Armen verteilt.
Der Guru wies ihn dann noch an, von den übrig bleibenden Opfern ein gewisses Quantum Reis, Ghie, Zucker u. s. w. zu nehmen und davon drei kugel runde Kuchen zu machen, von denen er je einen jeder seiner drei Frauen unter gewissen Zeremonien zu essen geben solle. Er begab sich nach Hause, nahm die Zeremonien vor und gab eine Kugel der Kahunsilya, eine der Kaosalya und die dritte der Kahikeya zu essen. Die letztere aber, als jüngste und begünstigte Frau, hatte sich beleidigt gefühlt, dass Dasaratha sie nicht zuerst mit seiner Gunst bedacht hatte, und hielt die Kugel schmollend in ihrer Hand, statt selbe gleich zu essen. In diesem Moment kam ein Drache dahergeflogen und entführte die Kugel in die Lüfte. Nunmehr war aber Kahikeya untröstlich, denn sie erkannte, dass sie jetzt, da die Zeremonie unvollendet geblieben war, die Aussicht auf ein Kind verloren habe. Durch ihren masslosen Schmerz und ihre Reue gerührt, überliessen auf Veranlassung von Dasaratha die beiden anderen Frauen je die Hälfte ihrer Kugeln der Kahikeya, welche selbe unter andächtigster Voll ziehung der betreffenden Zeremonien auch verzehrte. Zu aller Freude fanden bald alle drei, dass sie alle in guter Hoffnung waren. Die von dem Drachen entführte dritte Kugel hatte aber ein ganz besonderes Schicksal. Eine verheiratete Brahmany namens Anjeni, die bisher kinderlos geblieben war,
hatte alle erdenklichen Opfer bereits gebracht, ohne bisher Erhörung gefunden zu haben, sie flehte aber fortgesetzt täglich so andächtig zu Mahadeva und vollzog so grosse Opfer vor dem Linga, dass sie die Gunst der zeugenden Gottheit, Rudra, so mächtig anzog, dass selbe ihr einen ganz aussergewöhnlich starken Nachkommen versprach. Sie solle ihre Augen nur auf die Sonne konzentrieren, die Flächen ihrer Hände in bittender Form gegen den Himmel halten, und das, was ihr aus den Lüften in die Hände fallen werde, solle sie sofort essen und dabei den Namen des Gottes anrufen. Der kugelrunde dritte Kuchen, den der Drachen entführt hatte, fiel nun in die Hände, sie ass denselben, wurde guter Hoffnung, und ein Sohn wurde ihr geboren, der so gross und stark war, dass er bei seiner Geburt einen grossen Stein, auf den er zu liegen kam, zu Staub zermalmte. Dieser Sohn war Hanuman.
In der Kedara Kalpa der Nahdi-upa-Purana werden zwölf Lingas als von höchster und transcendentaler Heiligkeit erwähnt. In dieser Purana sagt Schiwa: »Ich bin allgegenwärtig, aber ich bin es ganz besonders in zwölf Formen und an zwölf Orten.« Es folgt dann eine Aufstellung von zwölf Örtlich keiten. Eine davon ist Ramasa zu Letabundha auf der Insel Ramissarum zwischen Ceylon und dem Festlande. Es wird berichtet, der Linga sei dort von dem Gotte Ram oder Ramâ errichtet worden.
Es ist einer der kostbarsten Tempel Indiens mit einem wunderbaren Tor, 100 Fuss hoch. In jedem dieser Tempel ist das einzige Symbol Schiwas oder Mahadevas, das die Andächtigen zu Pilgerfahrten nach den Tempeln veranlasste, ein Lingam. Der Kultus der Saivas war also reiner Phalluskultus.
Hier ist es angezeigt, diesen Kultus der Lingam- Verehrung etwas genauer zu definieren und auf gewisse Unterschiede hinzuweisen zwischen zwei Dingen, die sogar von Forschern häufig verwechselt werden.
Es sind das feine Unterschiede, die zwischen der Verehrung der Naturkraft und der Gotteskraft gemacht werden.
Die rohe Naturkraft wird in Prakriti personifiziert. Sie wird als »die Natur an sich, die Erde, die matrix der Natur betrachtet. Sie umschliesst daher alle Kräfte oder sacti dieser Eigenschaft. In ihrem Urzustand war diese Kraft eigentlich passiv, sie war nur eine Neigung, eine Möglichkeiten enthaltende Kraft, die schlummernd lag, bis sie durch bija, das belebende Prinzip, die aura der Natur, personifiziert im Gott Schiwa, der in dieser Eigenschaft den Namen Parusha oder das Urmännliche führte, geweckt wurde. So haben wir also das passive und das aktive Prinzip vor uns. Prakriti ist einer der Namen und Formen für Parvati, wie es Parusha für Schiwa ist. Das passive göttliche Gebärungsprinzip ist sym-
bolisiert in Yoni, und das lebenerweckende, aktive, göttliche Zeugungsprinzip ist symbolisiert im Linga.
Die (aufsaugende und haltende) gebärende Kraft und Eigenschaft, welche in der Yoni symbolisiert wird, führt bei den Hindu-Mystikern auch die Bezeichnung Argha. Mit diesem Namen bezeichnet man auch einen flachen, länglichen Teller, Napf oder Untersatz von Tunkenschüsseln, in dem Blumen und Früchte bei Opferungen den Göttern dargebracht werden. Diese Näpfe oder Teller sollten stets schiffähnlich geformt sein. Der Rand der Argha wird eigentlich als Yoni im engeren Sinne des Wortes bezeichnet, während der aus dem Mittelpunkt der Argha senkrecht emporragende Schiwa der Linga ist. Man nennt daher diese Zusammenstellung der beiden Symbole auch Arghanâta oder Herr des schiffgeformten Gefässes.
Der Gelehrte Mr. Wilford stellt die Theorie auf, dass die Argha, als Typus der Eigenschaft und Fähigkeit der »Empfängnis« von der zeugenden Kraft und Eigenschaft des Linga oder Phallus zum Leben gebären angeregt und erweckt, mit dem griechischen Schiff Argo identisch sei. Gemäss Orpheus war das Schiff Argo von Juno und Pallas gebaut, Apollonius dagegen sagt, es sei auf Veranlassung von Juno von Pallas und Argus gebaut worden. Das Wort Yoni, wie es gemeinhin ausgesprochen wird, erinnert lebhaft an Juno, und die
Sanskritworte Arghanatha Iswara werden von Plutarch richtig dahin ausgelegt, dass Osiris der Befehlshaber (Herr) des Argo war. Dass die Sanskritworte p’halla (Frucht) und p’hulla (Blume) identisch seien mit phallus, ist nicht erwiesen. Eine auffallende Ähnlichkeit ist jedoch vorhanden. Und man wird umso mehr zur Annahme einer Verwandt schaft zwischen denselben hingedrängt, als Blumen und Früchte bekanntlich die Hauptopfergaben für die Argha und gleichzeitig den Linga sind. Beweise sind auch vorhanden, dass Mahadeva selbst der Prototypus des Linga, in der Argha stehend, dar gestellt wird. Dadurch soll eine vollkommene, mystische Drei-Einheit von Kräften dargestellt wer den. Diese Drei-Einheit besteht aus Wischnu, dem Prinzip der Feuchtigkeit und der Erhaltung, selbe ist symbolisch ausgedrückt in einer Konvexität oder Erhebung in der Mitte der Argha, über welche das Ebenbild von Mahadeva oder p’halla und p’hulla, den Linga oder Phallus vorstellend, gesetzt ist. Die Annahme, dass die Sanskritworte p’halla und p’hulla derselben Quelle entspringen wie das griechische Wort phallos, phallus, wird durch die Tat sache unterstützt, dass Mahadeva in seinem dem Jupiter Marina oder Neptun entsprechenden Charakter einen Dreizack als sein Attribut in der Hand hält. Dieser Dreizack wurde Triphulla oder auch Tripholla genannt, wodurch dreifaches Blühen und Erspiessen
ausgedrückt werden sollte. Jupiter Triphylus ist identisch mit dem dreiaugigen Schiwa.
Die schiffgeformte Argha gilt als Typus der Welt. Folgende Ausführungen sollen diese Eigenschaft näher erläutern. In der grossen Wassernot (die sogenannte Sintflut), welche die Welt einstmals heimsuchte und verheerte, fand sich das zeugende sowie gebärende Element in der Natur auf ihre ein fachsten und elementarsten Bestandteile oder Prinzipien reduziert. Der Linga und die Yoni nahmen infolgedessen diese besondere Form an, um die Menschheit zu erhalten. Der Sage nach lag Brahma, die Schöpferkraft, in einem Abgrund schlafend. Brahma war hier abstrakt als die dem Untergang geweihte Menschheit darstellend angenommen. Das in Yoni verkörperte Prinzip nahm die Form eines Schiffes (Boot oder Kahn) an, während der Linga den Mast des Bootes oder Schiffes bildete und so vereint beide, von Wischnu beschützt, auf den Wassern schwimmend sich erhielten und perpetuierten.
Man erklärt daher auch die Arche Noah (und im erweiterten Sinne die Arché-Form zeigende Bundeslade eines freimaurerischen Systems) als ein phallisches Symbol.
Gewisse Mystiker sehen die beiden Prinzipien, die durch den Linga und die Yoni symbolisiert werden, überhaupt in allen möglichen Gegenständen
und Dingen in der Natur u. s. w., die entweder ge höht sind oder senkrecht zum Himmel streben. So z. B. die Erde, der See, ein Boot, ein Brunnen, ein Teich, die Höhlung der Hand, Felsenrisse, Höhlen werden als zum Prinzip Yoni gehörig klassifiziert, während Berge, besonders solche, die eine Kegel form haben, Türme, Pyramiden, konische Hügel, Masten, Bäume, Obelisken, loderndes Feuer als zum Prinzip, das durch Linga symbolisiert wird, gehörig betrachtet werden. Die Erde wird durch ein Boot, Schiff symbolisiert, das bei den Hindu Argha und bei den Ägyptern Cimbium genannt wurde. In Ägypten wird Osiris im Boot dargestellt, und in Indien finden wir, in getreuer Analogie, den Gott Mahadeva aufrecht in der Mitte der Argha stehend.
Seely sagt: In Indien bemerkte ich noch in heutiger Zeit folgende Vorkommnisse. Grosse Haufen von Steinen kann man längs der Landstrasse zu sammengetragen finden, auf welchen kleine Fahnen von schmutziger ziegelroter Farbe stecken. Jeder fromme Wanderer fügt im Vorbeigehen diesem Haufen einen neuen Stein bei, bis derselbe so hoch wie ein kleiner Berg wird. Wenn irgendeiner dieser auch nur einigermassen die Form von Maha devas Linga hat, so wird er ganz gewiss ausgezeich net und ausgewählt, um an bevorzugter Stelle aufrecht hingepflanzt zu werden, und dann wird er mit Öl und rotem Ocker beschmiert, der besonderen
Farbe Brahmas. Diese Verehrung für Steine finden wir schon in der Bibel, Genesis 28, V. 18, erwähnt. Es heisst dort: »Und Jakob stund des Morgens frühe auf und nahm den Stein, den er zu seinen Häupten gelegt hatte, und richtete ihn auf zu einer Säule und goss Öl oben auf die Spitze.«
Höhlen wurden als Repräsentanten von Yoni betrachtet wegen ihrer haltenden, bergenden Eigen schaft und wegen der Form ihrer Einlassöffnung. Das älteste Orakel und die älteste Stelle einer Gottesverehrung war zu Delphos die Erde in einer Höhle, welche Delphi genannt wurde. Dieses veraltete griechische Wort war gleichbedeutend mit dem Sanskritwort Yoni. Nach der Ansicht des frommen Hindu sind Höhlen das Symbol der geheiligten Yoni. Ähnliche Ansichten herrschten auch im Abendlande, denn die ersten Christen nannten Risse und Sprünge in Steinen und Felsen Cunni Diaboli. Dazu muss bemerkt werden, dass die ersten Christen die Gewohnheit hatten, die Gottheiten der »Heiden« als Teufel zu bezeichnen. Durchlochte Steine findet man in Indien sehr häufig, und fromme Leute zwängen sich durch die Öffnung der selben, sowie das Loch nur einigermassen gross genug dafür ist, weil sie annehmen, dass sie dadurch regeneriert, verjüngt, resp. wie neu geboren werden. Ist das Loch des Steines zu schmal zum Durchzwängen für eine Person, so stecken die Leute
wenigstens eine Hand oder einen Fuss oder beides durch das Loch, und bei genügend starkem Glauben erreicht der Fromme die gleiche Wirkung.
Eines der sieben Wunder des Peak in Derbyshire wird »Devils Cavern« (Teufels Höhle) genannt, aber mit Unrecht, denn diese wundervolle Höhle, beziehungsweise ihr Gegenstück auf den heiligen Inseln, die besondere Erwähnung finden in den Puranas, wird als Symbol der geheiligten Yoni erklärt und bezeichnet. Der Spalt in Nepaul, der den Namen »Guhya-sthan« führt, korrespondiert genau mit dem Namen, der den anderen in Derbyshire führt, ist jedoch in Indien ein viel besuchter Wallfahrtsort gläubiger Hindus. Die Geschichte fast aller Nationen weist zu irgend einer Zeit eine göttliche Verehrung von Steinen auf. Die Hindus bewahren dieselbe heute noch. Die Hindus behaupten, dass die Verehrung von monolithischen Gegenständen, wie z. B. der Kaaba zu Mekka, der Obelisken in Ägypten, des dreisäuligen Tempels zu Stonehenge u. s. w., nichts anderes sei als ihr eigener Lingakultus, nur unter anderem Namen und anderer Form.
Eines der berühmtesten Linga-Symbole ist das Vorgebirge Malabar Point bei Bombay. Das Vorgebirge oder die Landzunge, welches mit seiner Spitze in das Meer hinausragt, hat Linga-Form. In früheren Zeiten war dasselbe ein sehr besuchter
Wallfahrtsort wegen seiner grossen Sünden vergebenden Eigenschaft. Mit dem Eindringen der Abendländer und dem Überhandnehmen einer ungläubigen Bevölkerungsklasse hörten die Wallfahrten nach und nach fast ganz auf, doch behält er in den Augen der gläubigen Hindus auch heute noch seine Kraft und wird von denselben als geheiligter Ort betrachtet.
Der Gebrauch des Durchziehens von sündigenden und kranken Gläubigen durch die heiligen Risse von Felsen erfuhr durch die Priester Indiens eine eigentümliche Variante. Die Priester hatten nämlich mit reichen und armen Sündern, sowie reichen und armen Kranken zu tun. Während für die armen Sünder und Kranken das einfache Durchziehen durch den Spalt vollständig genügte, erfanden die Priester für die Reichen eine »wirksamere« Form. In gewissen geeigneten Fällen verlangten die Priester, dass eine goldene Nachbildung des weiblichen Reproduktionsorgans gemacht werde (in gewissen Fällen wurde die Form der Kuh gewählt), und eingeschlossen in diese goldene Form wurde dann die betreffende Person durch den Spalt gezogen.
Als seinerzeit der unglückliche Raghu-Nath-Raja zwei heilige Brahminen als Botschafter nach England gesandt hatte, kehrten diese beiden Brahminen unvorsichtigerweise über den Indus zurück. Da es nun für einen frommen Brahminen eine grosse Sünde
ist, den Fluss Indus zu überschreiten, so wurden die beiden heiligen Männer nach ihrer Rückkehr als »Outcasts« (Ausgestossene) behandelt. Dem Einflusse Raghu-Nath-Rajas gelang es aber endlich, dass die heilige Synode oder Versammlung der Brahminen dahin entschied, die beiden entweihten Brahminen könnten von ihren Sünden gereinigt werden, wenn selbe in einer aus Gold gefertigten Form der geheiligten Yoni eingeschlossen durch den Spalt gezogen würden. Raghu-Nath-Raja liess eine derartige Form aus Gold herstellen, seine Botschafter wurden in dieselbe eingeschlossen, durch den Spalt gezogen, danach als gereinigt erklärt und in die Gemeinschaft der Gläubigen wieder aufgenommen.
Dem gläubigen Hindu war sogar die Art der Feuererzeugung durch das Reiben von einem konischen Stück Holz in einem gelochten Holz das Symbol von Lingam-Yoni. Jeder Brahmine musste eine derartige feuererzeugende Maschine, genannt Arani, besitzen. Bemerkenswert ist, dass es zu einer Gegnerschaft in den Kreisen der Lingam-Yoni-Verehrer gekommen ist, indem eine Klasse von Gläubigen dem Lingam mehr göttliche Kraft zuschrieb, wie der Yoni, und eine andere Klasse umgekehrt erklärt, dass die Yoni mehr göttliche Kraft besitzt als der Lingam. Es kam sogar zu heftigen Kämpfen zwischen den beiden streitenden Parteien.
Diesem Streite liegt folgende Legende zu Grunde.
Als Sarti nach Schluss ihres Daseins als Tochter Dacshas wieder ins Leben kam als Parvati, wurde sie dem Mahadevah wieder vermählt. Dieses göttliche Paar hatte eines Tages eine Meinungsverschiedenheit über den Einfluss des Geschlechtes auf die belebten Geschöpfe, und sie beschlossen, eine neue Art und Rasse von Menschen zu schaffen. Die von Mahadevah geschaffene Rasse war sehr zahlreich und zollte nur dem männlichen Prinzip göttliche Verehrung, aber sie hatten verkümmerte, schwache Körper, schwaches Intellekt, ihre Glieder waren verzerrt und ihre Gesichtsfarbe schillerte in allen Nuancen. Parvati hatte dagegen auch eine zahlreiche Klasse Menschen geschaffen, die nur dem weiblichen Prinzip göttliche Verehrung zollten, und diese waren von schöner Gestalt, scharfem Verstande und hatten schöne Gesichtsfarbe. Zwischen beiden Klassen entstand ein heftiger Kampf, und die Lingajas wurden in der Schlacht geschlagen. Mahadevah, zornentbrannt über die Niederlage seiner Geschöpfe, verbannte die Yonijas aus dem Lande.
Durch die Vermittlung von Parvati beruhigte sich Mahadevah wieder, aber in Zukunft genoss Linga und Yoni gemeinsam wieder göttliche Verehrung.
KAPITEL IV.
Mahadevah-Legende. Diodorus Sicculus über Osiris. Ptolemäus Philadelphus. Die Waischnavas. Hindu-Sekten. Anbetung der Matrix. Die Verehrung des Prinzips der weiblichen Reproduktion. Fakire und die Hindufrauen. Macht und Einfluss des Phallismus in Indien. Hindu-Gebete und Zeremonien.Folgende Legende über Mahadevah zirkuliert unter den gläubigen Hindus in Indien.
Eines Tages, als Mahadevah nackt, nur mit einem Stab ausgerüstet, auf Erden wandelte, kam er an einem Ort vorbei, wo mehrere Munis ihre göttliche Verehrung verrichteten. Mahadevah verlachte dieselben und provozierte sie durch unschickliche Gesten und Zeichen. Die beleidigten Munis verfluchten Mahadevah, und daraufhin fiel ihm sein Linga oder Phallus zur Erde. Mahadevah umkreiste nun in diesem verstümmelten Zustande die Welt und beklagte sein Unglück. Seine Gemahlin gab sich ihrem untröstlichen Schmerze hin und verfolgte ihren verstümmelten Gatten mit Trauergesängen. In der griechischen Mythologie ist das Gegenstück
hierzu die Wanderungen Demeters und die Klagen Bacchus.
Da die Welt dadurch des belebenden und schaffenden Prinzipes verloren gegangen war, so kam Generation und Vegetation zu einem vollkommenen Stillstand. Götter und Menschen wurden ängstlich und zu Tode erschrocken. (Ähnliches symbolisiert Richard Wagner im Rheingold, wenn Freia von den Riesen entführt wird.) Nachdem sie die Ursache entdeckt hatten, gingen alle auf die Suche nach dem verlorenen Linga. Endlich fanden sie denselben. Derselbe war zu einer ungeheuren Grösse gewachsen und mit Leben und Bewegung ausgestattet. Nachdem sie dem wiedergefundenen heiligen Linga göttliche Verehrung gezollt hatten, schnitten sie denselben in 31 Stücke, von denen jedes polypenartig sofort ein vollkommener Linga wurde. Die frommen Finder liessen 21 auf Erden. Neun trugen sie in den Himmel und einen sandten sie in die Unterwelt, so dass die Bewohner aller drei Welten die Wohltaten des heiligen Linga geniessen sollten. Um Devi zu genügen und um alles wieder, wie es vorher war, herzustellen, wurde Mahadevah in der Person Baleswara oder Iswara wiedergeboren, das Kind war aber sofort Mann, und unter dem Namen Lileswara oder Iswara (der, der Entzücken verschafft) fand er seine Gattin in Sami Rama (die Semiramis der Griechen), welche durch
den Zauber ihrer Person ihren ehemaligen und zukünftigen Gatten so mächtig anzog, dass Gott und Göttin sehr bald wieder in glücklicher Ehe vereint waren.
Die Hindus behaupten, dass der schwarze Stein in der Wand der Kaaba nichts anderes sei, als der Linga oder Phallus des Mahadevah. Als Mohammed die Kaaba wieder herstellte, stellte er den Linga dort auf, um denselben der Verachtung der Gläubigen preiszugeben. Die erst neubekehrten Anhänger Mohammeds, statt dass ihnen als bisher heilig bekanntes Symbol zu verachten, zollten demselben weiter göttliche Verehrung, und die Priester der neuen mohammedanischen Religion waren schliesslich gezwungen, durch die Finger zu sehen, und die missbräuchliche Anbetung zu dulden.
Die Hindu-Astronomen nehmen an, dass die Zerschneidung des Baleswara-Gliedes in 31 Phalli ein Versuch gewesen sei, den Lauf des Mondes mit dem der Sonne in Übereinstimmung zu bringen, indem die synodische Umdrehung in 31 Teile geteilt wurde, welche auch 310 Jahre vorstellen. Man schreibt diesem Ereignis den Ursprung des Linga- oder Phalluskultus zu. Es soll sich an dem Ufer des Euphrat ereignet haben, und dort soll auch der erste Phallus unter dem Namen Baleswara Linga aufgerichtet worden sein.
Diese Version wird von Diodorus Sicculus bestätigt, welcher berichtet, dass Semiramis aus den armenischen Bergen einen Obelisk brachte und selben auf einer von überall sichtbaren Stelle in Babylon aufrichten liess. Derselbe war 150 Fuss hoch und wurde von Diodorus Sicculus zu den sieben Wundern der Welt gezählt. In Talmud wird auf dieses Symbol Bezug genommen. Indem derselbe die verschiedenen Erden aufgezählt, aus denen Adam geschaffen worden sei, wird gesagt, die Erde, aus der Adams Zeugungsorgan geschaffen wurde, sei aus Babylon gebracht worden.
Diodorus Sicculus erzählt weiter, dass Osiris, nachdem er um die ganze Welt gereist und der Wohltäter der Menschheit geworden war, gestorben sei. Die Art seines Todes wurde jedoch von den Priestern geheim gehalten. Aber nach einiger Zeit wurde es ruchbar und öffentlich bekannt, dass Osiris von seinem neidischen Bruder Typhon ermordet worden sei, der seinen Körper in 26 Teile zerstückelt hatte und dann jedem seiner Komplizen ein Stück des Toten gegeben hatte, damit auf jedem die gleiche Schuld wie auf ihm lasten solle. Isis, mit Hilfe ihres Sohnes Horus, rächte jedoch den Tod ihres Gatten Osiris an Typhon und seinen Komplizen und bemächtigte sich des Reiches. Sie suchte dann eifrigst nach den einzelnen Stücken ihres Gatten und fand schliesslich alle bis auf ein Stück, nämlich sein Zeugungsorgan.
Sie setzte die einzelnen Stücke sorgfältigst wieder zusammen, befestigte selbe mit Wachs und Spezereien, und nachdem sie die Figur des Osiris bis auf das fehlende Stück wieder hergestellt hatte, übergab sie selbe der Obhut der Priester und setzte zu Ehren ihres ermordeten Gatten die mystischen Zeremonien und Riten von Isis und Osiris ein. Sie verpflichtete die Priester, ihr Geheimnis streng zu bewahren, und jedesmal, wenn die Riten in feierlicher Weise abgehalten wurden, fand auch eine symbolische Suche nach dem fehlenden Glied statt. Dieses war von Typhon in den Nil geworfen worden, da niemand dasselbe bei sich verwahren wollte. Isis befahl deshalb, dass eine Nachbildung desselben (aid oion) hergestellt werde, dass man es in den Tempeln aufstelle und demselben göttliche Verehrung zolle. Nachdem die Griechen die Riten und Zeremonien der Bacchus-Feste und der Orgian-Feierlichkeiten von den Ägyptern kennen gelernt hatten, übernahmen sie diesen Gottesdienst unter der Bezeichnung Phalluskultus. Infolge eines Befehles der Isis wurden Nachbildungen des männlichen Zeugungsorganes angefertigt, auf Stangen befestigt und während der Feste und Feierlichkeiten zwecks öffentlicher Verehrung und Anbetung umhergetragen.
Athenaeus erzählt, dass bei einer dieser feierlichen Festlichkeiten Ptolemäus Philadelphas den
Ägyptern einen Phallus zeigen liess, der aus reinem Gold gefertigt, kostbar bemalt und mit goldenen Kronen verziert war. Er war 120 Ellen (Kubitus) lang, hatte einen goldenen Stern auf der Spitze und mass sechs Ellen im Umfang. Er wurde gleich den anderen Göttern auf einem goldenen Wagen umhergefahren, und die staunende Menge zollte dem Symbol göttliche Verehrung.
Die Waischnavas, um das schaffende und zeugende Prinzip für Wischnu zu reservieren, lassen Brahma, den sie als die unmittelbare schaffende Kraft anerkennen, aus einem Lotos abstammen, dieselbe auf den tiefen Abgründen der Urwasser schlafend dahinschwamm. Dadurch wollen sie für Wischnu, dem Brahma gegenüber, eine Priorität und einen Vorrang schaffen, so dass er die erste Ursache Brahmas und damit der Existenz aller geschaffenen Dinge wurde.
Die Argha ist ein kupfernes Gefäss, das die Brahminen in der Puja-Zeremonie benützen. Die Form der Argha soll die »Mutter des Universums« darstellen, in der Mitte derselben ist eine gestanzte Erhöhung. Die Waischnavas behaupten, diese Erhöhung stelle den Nabel Wischnus dar, dem alle existierenden Dinge entsprungen seien. Die Saivas (Schiwa-Sekte) behaupten jedoch, dass diese Erhöhung das Symbol des Linga ist. Deshalb führt
Siva oder Schiwa den Titel Arghanatha und in der Agama, Argha-Isa. Beides heisst so viel als: Herr des geheiligten Gefässes Argha. Wischnu wird in der zehnten Avatar als die zerstörende Kraft hingestellt. Man teilt ihm dort also eine Eigenschaft Schiwas zu. Die Waischnavas stellen Wischnu mit vier Armen dar, in jeder Hand ein Symbol haltend. Diese drei Symbole stellen seine drei grossen Eigenschaften dar und drücken seine Herrschaft über das Weltall aus. Der Lotos stellt seine schöpferische Kraft vor (als Hinweis auf den Lotos, der seinem Nabel entsprang). Das Sandscha stellt seine erhaltende Kraft vor und das Szepter die Macht der Vernichtung. Das Chacra (als Chacra-Varti, Herr des Chacrá) symbolisiert seine Weltherrschaft. Wenn dieses letztere Symbol in Verbindung mit einem gelehrten Brahminen gebraucht wird, so deutet es an, dass der betreffende Brahmine sämtliche Wissenschaften beherrscht. Als man aufhörte, die personifizierten Eigen schaften der Gottheiten als blosse Hieroglyphen zu betrachten und die Anhänger der einzelnen Gott heiten sich in Sekten teilten, proklamierten die Schiwa-Anbeter das Dogma von der Ewigkeit der Materie. Um den anscheinenden Gegensatz zwischen der Eigenschaft der Erhaltung und der Eigenschaft der Vernichtung, die beide ein und demselben Gotte zugeteilt waren, auszugleichen, erklärte man, dass
die Auflösung und Vernichtung der materiellen Körper keine Realität sei, die Materie sei unzerstörbar, ewig, aber sie sei hinsichtlich der Form einer fortgesetzten, unaufhörlichen, ewigen Wandlung unterworfen. Die Kraft nun, die diese unaufhörlichen Wandlungen hervorrief und verursachte, müsse naturgemäss und folgerichtig in sich selbst die Kraft der Schöpfung und die der anscheinenden Zerstörung vereinigen. Diese Kraft und die Materie (Kraft und Stoff) seien zwei bestimmte, co-existierende Prinzipien in der Natur, das erste das aktive Prinzip, das letztere das passive Prinzip oder das männliche und das weibliche Prinzip, und der Schöpfungsakt ist eben das Resultat der mystischen Vereinigung dieser beiden gegensätzlichen Prinzipien. Die hieroglyphische Darstellung dieser Vereinigung (mystischen Hochzeit) genoss unter den verschiedensten Namen göttliche Anbetung und Verehrung, z. B. Bhava und Bhavani, Maha Deva und Maha Maya (aus Maya entstand später Maria) u. s. w. Der Umstand, dass die Anhänger des Schiwa das Attribut und die Eigenschaft der Schöpfungs kraft des Brahma für Schiwa reklamierten und ihren Gott somit sozusagen unrechtmässig mit der Schöpfer kraft ausstatteten, führte zur Sektenbildung. Zuerst entstanden nur zwei Sekten, späterhin kam eine dritte hinzu. Von den zuerst entstandenen zwei Sekten personifizierte die eine das Weltall und
die darin wirkende und waltende schöpferische Kraft durch eine Göttin, genannt Prakriti. Die Anhänger dieser Sekte nannten sich Sacta, weil sie die weib liche Kraft (Reproduktionskraft des weiblichen Organs), genannt Sacti, anbeteten und verehrten. Die andere Sekte erklärte, dass es nur eine erste ewige Ursache gebe, und dass alles, was entsteht und existiert, einzig und allein dieser einen ersten Ursache seine Existenz verdankt. Um die absolute Unabhängigkeit dieser ewigen ersten Urkraft von der Mitwirkung einer anderen Kraft aus zudrücken, wählten die Anhänger dieses Dogmas zu ihrem Symbol das männliche Zeugungsorgan, aber ohne alle Verbindung mit dem weiblichen Reproduktionsorgan. Späterhin entstand naturgemäss eine dritte Sekte, welche die vorhandenen Gegensätze zu versöhnen und auszugleichen suchte. Sie stellten den Lehrsatz auf von der Einheit der Gottheit mit und im Geist und in der Materie (Dreieinigkeit). Sie erklärten, die Vereinigung der beiden gegensätz lichen Prinzipien sei so geheimnisvoll innig, so dass in derselben sie nur ein Wesen bilden. Und diese Idee brachten sie durch eine Figur, die halb männlich, halb weiblich war, symbolisch zum Ausdruck. Dieses Mann-Weib nannten sie Hara-Gauri und auch Ardhanari-Is-Wara. Die gleiche androgyne Gott heit findet man bei den christlichen Gnostikern und
bei den schismatischen Tempelrittern, also noch im Mittelalter christlicher Zeitrechnung. Spätere Kapitel dieses Werkes werden die dokumentarischen, auch bildlichen Beweise erbringen, dass noch im christlichen Mittelalter einer androgynen Gottheit göttliche Verehrung gezollt wurde. Diese Sektenbildung führte zu groben Auswüchsen und Verirrungen. Die Quellenbücher sagen über diese Sekten bildung folgendes: »Die Waischnavas sind in viele Sekten geteilt, deren Gegenstand göttlicher Anbetung, obgleich derselbe bei allen gemeinsam göttliche Verehrung geniesst, von den einzelnen Sekten in einer mehr oder weniger abweichenden Form verehrt wird, je nach dem Ritus, der von den betreffenden Gemeinschaften gepflegt wird. Zu diesen Sekten gehören unter anderem die Goculasthas, die Yonijas, die Romani, die Radhaballubhis.« Es dürfte von Interesse sein, die Gebräuche einiger dieser besonders genannten Sekten auszugsweise zu erwähnen. Die Goculasthas verehren Krischna, während die Romani dem Ramchunda göttliche Anbetung zollen. Innerhalb dieser beiden Sekten besteht aber noch eine Untersekte, welche ausschliessliche Anbeter Krischnas sind, und diese allein werden eigent lich als die wahren und einzigen orthodoxen Waischnavas betrachtet. Krischna ist für diese ein avata oder eine Inkarnation Wischnus.
Als Parameswarra ist Krischna der Jaganath oder Herr des Universums und wird schwarz dargestellt, der anscheinenden Farbe des Äthers oder Weltenraumes. Deshalb sind die Lingas des Krischna auch von schwarzer Farbe, während die von Schiwa von weisser Farbe sind. Die Lingionijas verehren Krischna und Radha in der Vereinigung in coitu. Die Radhaballubhis widmen ihre Opfer der Radha allein, als der Sacti oder weiblichen Reproduktionsenergie des Wischnu. Sie verehren Radha in der Person eines nackten Mädchens, dem sie ihre Opfer gaben, die für die Göttin bestimmt sind, darbieten. Mit anderen Worten, das Mädchen spielt die Rolle der Göttin Radha ungefähr in derselben Art oder in derselben symbolischen Weise, wie im Mittelalter ganz allgemein, und in vielen katholischen romanischen Gegenden heute noch, bei besonderen Festen Mädchen die Jungfrau Maria darstellten. Wenn die Anhänger dieser Sekte sich auf Reisen befinden und ein Mädchen zu dieser gottesdienstlichen Hand lung ihnen nicht zur Verfügung steht, dann bringen sie ihre Opferungen einer Nachbildung der Yoni dar, welche eine Nachbildung der pudendum muliere ist. Sie werden deshalb auch nur Yonijas genannt, als Anbeter der weiblichen Sacti oder Reproduktionsenergie, im Gegensatze zu den Linga yets oder Anbeter des Phallus. Diese Anbetung der nackten Mädchen ist der Sekte der Sactas eigen
tümlich und gehört schon in den Bereich der schwarzen Magie oder der Tantrica. Die göttliche Anbetung des weiblichen Reproduktionsorganes, abgesondert von der Gottheit selbst, scheint seinen Ursprung in der buchstäblichen Auslegung der bildereichen Sprache der Wedda zu sein, in der der Begriff Wille oder Absicht, das Weltall zu schaffen, dargestellt ist als vom Schöpfer ausgehend und mit ihm co-existierend, als Sacti oder Braut, ein Teil seines eigenen mit ihm vereinten Seins ist. In der Sama Wedda, sprechend von der göttlichen Ursache der Schöpfung, wird gesagt: »Er empfand keine Glückseligkeit, da er vereinsamt allein war. Er wünschte sich sehnlichst eine Genossin, und sein Wunsch ward augenblicklich erfüllt. Er verursachte seinen Körper, sich zu teilen, und er wurde männlich und weiblich; diese vereinten sich, und menschliche Wesen erwuchsen der Vereinigung.« Unbegreiflich und unverständlich bleibt dem Abendländer die Verehrung, die von seiten der Frauen in Indien die herumziehenden schmutzigen Fakire geniessen. Das Wort Fakir ist arabischen Ursprungs und bedeutet ein Armer. In Indien bezeichnet man damit eine Klasse herumziehender, fanatischer Bettler, die meistens von Schmutz starren. Durch gewisse Torturen, denen sich diese Bettler aussetzten, erlangen sie gewisse absonderliche Fähigkeiten, die sie in den Ruf der Heiligkeit bringen.
So zum Beispiel sei nur angeführt, dass manche Fakire die Hand so lange krampfhaft schliessen, bis die Fingernägel durch das Fleisch wachsen, oder den Arm so lange steif halten, bis er nicht mehr gebogen werden kann, oder sich bis an den Hals in eine Grube mit Erde eingraben und tagelang ohne Trank und ohne Nahrung bleiben. Wenn ein derartiger Fakir sich einem Dorfe näherte, so strömten die Bewohner aus ihren Behausungen, um den heiligen Mann zu begrüssen und in seiner Gesellschaft zu sein. Die Frauen aber, besonders diejenigen, welche Nachkommenschaft wünschten, übertrugen die sonst dem Symbol erzeugten Verehrungen dem entsprechenden Gegen stand am lebenden Manne. Auch in anderer Art prostituieren sich die Frauen den Fakiren. Es lässt sich dies nur dadurch erklären, dass die Männer ihre Frauen meistens gröblichst misshandelten, wenn selbe keinen reichen Kindersegen aufweisen konnten. Nach einer oberflächlichen Schätzung gab es Ende des vorigen Jahrhunderts ungefähr zwei Millionen Fakire, die Hindus und Mohammedaner zusammen gerechnet. Die ungeheure und ausserordentliche Macht, die die phallische Idee und der Phalluskultus über Hindus ausübt, wird am deutlichsten ausgedrückt durch die allgemeine Verbreitung der besonderen Gegenstände, welche auf Grund dieses Kult göttliche Verehrung
geniessen. Man findet kaum in einer anderen Reli gion eine gleiche Macht auf das Gemüt der Anhänger ausgeübt. In geringerem Masse findet man sie vielleicht in den romanischen Ländern von der katholischen Kirche ausgeübt. Die Hindus stellen sich eine Säule vor, die von den höchsten Spitzen bis ins Zentrum der Erde reicht und 84 000 yojans hoch, an der Spitze 32 000 breit und an der Basis 16 000 im Umfang ist. Selbe hat eine runde Form und steht mit dem schmäleren Ende im Mittelpunkte der Erde. Eine ähnliche Idee herrschte zu Cleanthes Zeit im Westen. Cleanthes behauptete, die Erde habe die Form eines Konus, diese Form bezog sich aber wohl auf den Berg Meru in Indien. Dieser Berg wird wie folgt beschrieben: »Der Berg Meru ist gänzlich aus Stein, 68 000 yojan hoch, 10 000 im Umfang und von der gleichen Stärke von oben bis unten.« Die tibetanischen Priester behaupten jedoch, dass er viereckig ist und die Form einer umgekehrten Pyramide habe. Einige der Buddha-Anhänger sagen, dass er die Form einer Trommel habe, mit einer Erhöhung in der Mitte, wie die Trommeln in Indien meistens sind. Sie nahmen diese Form an, um durch dieselbe die symbolische Vereinigung der beiden Urprinzipien und schaffenden Urkräfte der Welt anzudeuten. Meru ist der heilige oder Ur-Linga, und die Erde, in die er hineinragt, ist die mystische Yoni oder
Urmatrix, geöffnet und ausgedehnt gleich der padma oder lotos. Die Konvexität im Mittelpunkt stellt den os tincae oder Nabel Wischnus vor. Die phy siologischen Mysterien des Lingam-Yoni-Kult werden auch durch die Lotusblume symbolisiert, welche so wohl die Erde, wie das zeugende und das gebärende Prinzip vorstellt. Der Keim oder Stempel ist beides, Meru und Linga; die Blütenblättchen sind die Berge, welche den Meru umgeben, sie versinnbildlichen auch die Yoni; die vier Blätter der calyx sind die vier Regionen, und die Blumenblätter sind die verschiedenen Inseln im Ozean, die Jambu umgeben; das Ganze schwimmt auf dem Wasser gleich einem Boot. Die Hindus sagen nicht wie die Chaldäer, dass die Erde die Gestalt eines Bootes (Arche) habe, sondern sie behaupten, dass zur Zeit der »grossen Flut« (die biblische Sintflut oder Sündflut) die zwei Urkräfte (des Zeugens und des Gebärens) die Gestalt eines Bootes (Yoni) mit einem Mast (Linga) annahmen, um das menschliche Geschlecht zu erhalten. Da dieses symbolische Boot auch Argha genannt wurde, so ist daraus wohl die biblische Arche entstanden. In der Ark-Maurerei wird, den heutigen Mitgliedern gewiss ganz unbewusst, diese phallische Idee der Arche perpetuiert. Bei den Ägyptern bedeutete Argha oder Cymbium ein Gefäss, Napf oder Platte, in der Früchte und Blumen der Gottheit geopfert wurden. Dieses Gefäss musste, wenn es die richtige
Form haben sollte, bootähnlich sein. Iswara wurde auch Arghanata, der Herr des bootgeformten Gefässes, genannt. Osiris wurde als der Befehlshaber, der Herr, der Argha dargestellt, und dieses Boot wurde von vielen Männern auf den Schultern getragen. Diese Männer nannte man Argonauten. Tacitus erzählt, dass die Sueven einem Schiff göttliche Verehrung zollten, dieses Schiff war zwei fellos gleich der Argha ein Typus der mystischen Yoni. Steinbilder der mit dem Linga vereinten Argha findet man überall in Indien als Götzenbilder. Dieselben werden mit Blumen geschmückt, und über den Linga wird Wasser gegossen. Der Rand stellt die Yoni und die fossa navicularis dar, und statt dem Linga wird oft Iswara, in der Mitte des Bootes auf recht stehend, abgebildet. Die Saiva-Anhänger unter den Hindus graben oft einen Teich in der Form einer Yoni, um gewisse Gnadenbeweise der Gottheit zu erlangen. Das Wasser, welches in diesem yoni- oder argha geformten Teich ist, stellt Wischnu vor, der eine Personifikation der Feuchtigkeit im allgemeinen ist und in diesem besonderen Falle Wischnus Nabel bedeutet. Wenn nun der fromme Saiva-Hindu findet, dass die erhofften Gnadenbeweise der Gott heit ausbleiben, so wird unter grossen Feierlichkeiten und besonderen Zeremonien, die je nach der Stellung des Hindu mehr oder weniger kostbar und glänzend
sind, an einem besonders heiligen und glückverheissenden Tage ein Mast in die Mitte dieses Yoni-Teiches versenkt und eingerammt. Der Mast stellt Schiwa respektive den Linga vor, und damit wird die typische Vereinigung der beiden Urkräfte feierlichst vollzogen. Diese Zeremonie der Einführung des Mastes in den Teich wird gewöhnlich die Hochzeit des Lingam und der Yoni genannt. Man findet vor vielen berühmten Tempeln in Indien Teiche, manche sind sogar von grosser Schönheit, aus deren Mitte ein Mast herausragt. Stufen aus Holzplatten sind angebracht, um den Mast oder Linga vom Ufer des Teiches erreichen zu können, und die frommen Hindus benutzen diese Treppen, um den Linga mit Blumen zu schmücken, Wasser über die Spitze desselben zu giessen oder brennende Lichter auf denselben zu stecken. Nach der Ansicht derer, die die Puranas zusammengestellt haben, wurde dem Phallus zuerst unter dem Namen Basé-warra-Línga an den Ufern des Cumu-daoti oder Euphrat göttliche Verehrung gezollt. Als Gründer des Kultus nennt man Baswada oder Basawapa, der Sohn des Madijah Rajah, ein Brahmine, der mit seiner Frau, Madeve, in der Stadt Hin-guleswur-parbutti-agharam auf der westlichen Seite von Sri Saila wohnte und die beide fromme Verehrer des Mahadeva oder Schiwa waren. Aus Inschriften, die sich auf dem grossen Singales-
warra Linga (einer der zwölf heiligen Linga) und auf dem Linga zu Keneri finden, lernt man, dass in Erhörung der Puja dieser beiden obengenannten der grosse Gott und die grosse Göttin sich diesen beiden Frommen manifestierten, indem sie aus den Symbolen auf wunderbare Weise ins Leben traten, während der Brahmine und seine Gattin den heiligen Akt der Opferung vor der Gottheit vollzogen. Man erblickt an der Basis des Lingam die heilige Handlung, in Relief in den Stein gemeisselt, dargestellt. Das Hauptmerkmal der Sekte der Waischnavas, welche Lingayetts genannt werden, ist, dass sie selbst irgendwo auf dem Körper eine Nachahmung des Linga tragen müssen. Diese Nachbildung ist aus Silber, Kupfer, Gold oder Bergkristall, gleich dem Fascinum der Römer und der jettatura der modernen Italiener. Es heisst: Die Götter sagten: »O Herr und Meister, was sollen wir tun?« Und Brahma antwortete: »Tut Busse, indem ihr die wiedergeborene Göttin anbetet! Sie wird dann die Form der Yoni annehmen und den Linga aufnehmen, wodurch die Schuld allein ausgelöscht werden kann. Solltet ihr auf diese Weise die gnadenreiche Hilfe der Göttin erlangen, so macht ein Schiff aus acht verschiedenen Arten von Blättern, stellt es in gekochten Reis und heilige Pflanzen, und nachdem ihr es mit heiligem Wasser gefüllt habet, weihet das Ganze unter den dafür geeigneten
Zeremonien und Gebeten und mit dem Wasser unter wiederholtem Beträufeln des Lingam. Nachdem ferner Parvati in der Gestalt der Yoni den Lingam aufgenommen haben wird, errichtet und weihet die Form des Lingam in der Yoni (Linioni), schmücket selbe mit Blumen, besprengt es mit köstlichen Wohlgerüchen, zündet Lampen und Spezereien vor denselben an, und unter Singen und Tanzen betet die Gottheit an und versöhnet Mahadeva. So werdet ihr ohne Zweifel die Vergebung und die Gnade der Gottheit erlangen.« Nachdem die Götter und Weisen diese Worte Brahmas vernommen hatten, eilten sie, den Schutz Schiwas und die Hilfe Parvatis zu erflehen, so wie Brahma sie angewiesen hatte. Und nachdem die Gottheiten dadurch auch wirklich versöhnt worden waren, empfing Parvati in der Gestalt der Yoni den Lingam, wodurch sie dessen verzehrendes Feuer besänftigte, und zum ewigen Gedächtnis dieses Ereignisses wurde der Lingam-Yoni-Kultus eingeführt und gepflegt.
KAPITEL V.
Vergleiche zwischen Ägypten und Indien. Hindu-Soldaten in Ägypten. Brahm Atma, die atmende Seele. Wachstum der Hindu-Religion. Schiwa-Verehrung. Benares. Lingayet. Eigentümlichkeiten der Hindu-Symbole. Unparteiisches Urteil über dieselben. Hinduismus als unsittlich verurteilt.Ein berühmter Forscher hat vor Jahren folgenden Vergleich zwischen dem Osiriskultus in Ägypten, dem Bacchuskultus in Griechenland und dem Schiwakultus in Indien gezogen: »In Ägypten wurde Osiris und in Griechenland Bacchus unter dem Zeichen und dem Symbol des Phallus verehrt. Unter diesem gleichen Symbol und Zeichen verehren heute noch die Eingeborenen Hindustans ihre Gottheit, und Phallus ist einer der Namen der Gottheit in Amara Singhas Wörterbuch. In Ägypten war ihm der Stier geweiht, und Plutarch erklärte, dass verschiedene Völker Griechenlands Bacchus mit einem Stierkopf dargestellt hatten, und dass die Frauen von Elis, wenn sie zu diesem Gotte beteten, den Ausdruck gebrauchten: er möge auf den Füssen eines Stieres
ihnen zu Hilfe eilen. In Indien wird er oft auf einem Stier reitend dargestellt. Darauf bezieht sich auch einer seiner Sanskrit-Namen. Er wird dort »Wrischadwja« genannt, was so viel heisst als »Dessen Zeichen ein Stier ist!« Eine Hindu-Fabel besagt, der Ganges entspringt den Locken Schiwas, daher kommt einer seiner Namen, nämlich Gangadhara. Einige Forscher nehmen an, dass der Name Osiris von Siris, der ägyptische Name für Nil, abgeleitet sei. Andere nehmen an, dass Siris vom Sanskritwort saras, das Fluss im allgemeinen, oder hier der Fluss bedeutet, abstamme. Isis ist die Gattin des Osiris, wie Isa die Gattin von Iswara oder Schiwa ist. Die Attribute und Eigenschaften der beiden Göttinnen korrespondieren genau so wie die der beiden Götter. Die fanatischen Verehrer Iswaras gleichen in ihren Rasereien genau den Bacchanten des Gottes von Naxos. Es ist bemerkenswert, dass verschiedene Bezeichnungen, die von den Griechen auf Bacchus angewendet wurden, auch bei den Hindus üblich waren; aber statt selbe auf Bagh- esa selbst anzuwenden, bezogen die Hindus selbe auf seinen Sohn. Beide Nationen haben aber die gleichen Legenden bezüglich der beiden Gottheiten. So nannten die Griechen Bacchus Demeter, der zwei Mütter hatte; die Hindus nennen Skanda, den Sohn Baghesas, Divimati mit der gleichen Bezeichnung. Pyrignes, das vom Feuer geborene, und sein Gegen-
stück im Sanskrit, Agnijia, sind beziehungsweise in Griechenland und Indien Bezeichnungen für Bacchus und Skanda. Diodorus erzählt, der Titel Thrianbus sei von der griechischen Gottheit nach deren Triumphen über die Inder angenommen worden. In gleicher Weise führt der Bacchus der Inder die Bezeichnung Tryambo. Ein Ereignis, das wir in den nachfolgenden Zeilen erzählen werden, illustriert in bemerkenswerter Weise die Ähnlichkeit der Kulten. Während des ägyptischen Feldzugs gegen die Franzosen erkannten die Hindu-Soldaten, welche aus Indien nach Ägypten gebracht worden waren, viele der mythologischen Formen, Bilder und Symbole, besonders den Stier und die Schlangen, als mit ihren eigenen heimischen Religionssymbolen gleich, oder doch sehr nahe verwandt, so dass sie sich sofort an ihre Offiziere mit der Behauptung wandten, die früheren Bewohner Ägyptens müssten ganz bestimmt Hindus gewesen sein. In grosse Erregung wurden sie aber versetzt, als sie den Tempel zu Hadja Silsili in Trümmer liegen sahen, den sie, nach den Symbolen und Figuren urteilend, für einen Tempel ihres eigenen Gottes Schiwa hielten. Obgleich es festgestellt ist, dass der Kultus aus dem vorgeschichtlichen, urgrauen Altertum stammt, so hat man doch noch nicht über alle Zweifel erhaben festgestellt, von welchem Volke er direkt stammt. Man nimmt an, dass jenes Volk mit samt
dem Lande und der Erde, dem Kontinente, bei einer der grossen Katastrophen, die unser Globus seit seiner Existenz durchzumachen hatte, untergegangen sein muss (Atlantis?!). Darin sind alle, die sich in das Studium dieses Gegenstandes mit wirklichem Eifer versenkt haben, einig, dass der Kultus von einem Volke stammt, das theoretisch tatsächlich nur an Einen Einzigen Gott glaubte, der Bruhm Atma oder die »atmende Seele« genannt wurde. Der Kultus dieser abstrakten Gottheit war ursprünglich höchst einfach und mit wenigen Zeremonien verbunden. Aus den Bedürfnissen der grossen Masse des Volkes heraus entsprang nun aus dem einfachen Kultus der abstrakten Gottheit ein Kultus, der die Gottheit durch eine Steinsäule symbolisch zum Ausdruck brachte, und diese Steinsäule wurde Linga genannt. Diese Linga-Steinsäule verkörperte den Gedanken der ewigzeugenden Natur oder göttlichen Schöpfungskraft. Man kann sich im Abendlande keine Vorstellung davon machen, mit welcher tiefen, ernsten Andacht dieses Symbol zu allen Zeiten verehrt worden ist. Alle Wohltaten, Gnaden, Güter u. s. w., die die Menschen von der Gottheit für sich erflehten, wie Kindersegen, gute Ernten, Gesundheit, Kraft, Ansehen u. s. w. wurden der gnadenreichen Wirkung des durch dieses Symbol verkörperten Gottes zugeschrieben. Später entwickelte sich aus dieser Einen Gottheit eine Art Dreifaltigkeit.
Aus diesem Brahm Atma oder auch Bruhm Atma entstanden die sogenannten drei Elemente, die den Namen trugen Brahma, Wischnu und Schiwa (Schöpfer, Erhalter, auch Erlöser und Vernichter). Diesen drei Elementen wurden die folgenden drei gunas oder Eigenschaften zuerteilt: Rajas (Leidenschaft), Sat (Reinheit) und Tumas (Dunkelheit), und nannte selbe die Trimurti. Später entstand die Institution der Avatas und Avataras, oder die grössere und kleinere Inkarnation, durch welche die eine oder andere Gottheit dieser Hindu-Dreifaltigkeit Teile ihrer göttlichen Kraft (Lebenskraft) Menschen und Tieren mitteilte. Daraus entsprang ein sich rasch verbreitender, grosser Götzendienst, indem die mannigfaltigsten Eigenschaften der Gottheit personifiziert wurden, und die personifizierte Eigenschaft vom blinden Volke für »Gott selbst« angesehen wurde, so dass das Volk unzähligen »Göttern« diente und selbe anbetete. Keiner dieser drei Haupt- und vielen Nebengötter genoss jedoch solche grosse Verehrung wie Schiwa, der dritte Gott der Trimurti. Das geschah wohl hauptsächlich auch aus Furcht. Denn als Gott der Vernichtung wurde ihm alles Blutvergiessen, alle verheerenden Krankheiten u. s. w. zugeschrieben, und man kann ihn als Gegenstück zum biblischen Moloch betrachten. Die Brahminen sagten auch stets, die anderen zwei Gottheiten sind gut und
wohltätig und fügen ihren Geschöpfen keinen Schaden zu, aber Schiwa ist mächtig und grausam, und deshalb sei es notwendig, ihn zu versöhnen und zu beruhigen. Über die allgemeine Verbreitung der Linga-Verehrung, welche identisch ist mit der Verehrung Schiwas, kann keinerlei Zweifel herrschen. Zur Zeit der Invasion Indiens durch die Mohammedaner war es fast der alleinbeherrschende Kultus. Das Götzenbild, das nach Mirkond von Mahmud Ghizni zerstört wurde, war ein Linga gewesen von vier bis fünf Ellen Höhe und entsprechendem Umfang. Es hatte der Namen Someswara oder Somnath getragen, einer der Namen, die Schiwa führt, und war einer der zwölf heiligen grossen Lingas gewesen.
Benares ist der Hauptsitz dieser Art des Linga-kultus, dort gab es 47 Lingas von höchster Heiligkeit. Einer davon war eine Verkörperung Schiwas unter dem Namen Wiweswarra. Ausser diesen 47 Lingas von höchster Heiligkeit gab es dort noch mehrere hundert Lingas von geringerem Ansehen und Wirkung. In Benares konzentrierte sich die Ausübung der Religion in der Anbetung der zeugenden und gebärenden Sexualkraft (Sacti), und das ganze religiöse Empfinden der Hindu-Bevölkerung dreht sich um und hängt an diesem Phalluskultus oder Lingam-Yoni-Gottesdienst. Trotz aller Auswüchse, die dieser Sexual-Gottesdienst mit Notwen-
digkeit mit sich bringt, ist die wirkliche Moral des Volkes auf keiner niederen Stufe wie in vielen Abendländern mit Völkern, die der christlichen Kirche angehören. Madame H. P. Blavatsky, die berühmte Verfasserin des Werkes »Isis Unveiled« (die enthüllte Isis), in dem sie über das Vorkommen der phallischen Symbole in christlichen Ländern schreibt, sagt: »Wir finden es höchst töricht und unklug von seiten katholischer Schriftsteller, die Schale ihres Zornes in Sätzen, wie der folgende einer ist, auszugiessen: In einer Unzahl von Pagoden nimmt der phallische Stein immer und immer, gleich dem griechischen batylos, die brutal unsittliche Form des Lingam an.....! Bevor diese Schreiber ein uraltes Symbol, dessen tiefe metaphysische Bedeutung von diesen Vorkämpfern der Religion der Sinnlichkeit par excellence, dem römischen Katholizismus, überhaupt nicht erfasst und verstanden werden kann, mit Dreck bewerfen, sollten sie in ihrer moralischen Entrüstung damit beginnen, die ältesten christlichen Kirchen als unsittliche Symbole niederzureissen und die Formen der Kuppeln ihrer Gotteshäuser umzuwandern. Der Tempel Mahody von Elephanta, der runde Turm von Bhangulpore, die Minarets des Islam sind die Muster gewesen für den (jetzt eingestürzten) Campanile von San Marco in Venedig, für Rochesters Kathedrale, den neuen Dom von Mailand u. s. w.
Alle diese Türme, Kuppeln und christlichen Tempelgebäude sind Reproduktionen der Uridee des lithos, des aufrechtstehenden Phallus. Aber auch in den christlichen Kirchen finden wir phallische Symbole. Besonders zu erwähnen sind die in den protestantischen Kirchen zu findenden zwei Steintafeln mit der mosaischen Dispensation, welche Seite an Seite, zu einem Stein vereinigt, auf dem Altar stehen, und deren obere Enden abgerundet sind. Der rechte Stein stellt das männliche Prinzip vor und der linke das weibliche. Es haben daher weder die Protestanten noch die Katholiken guten Grund, mit Verachtung auf die Völker zu schauen, die den Lingam-Yoni-Kultus pflegen.
KAPITEL VI.
Crux Ansata und das Kreuz. Irrige Ansichten über das Kreuz. Heidnischer Ursprung des Kreuzes. Monumente und Grabdenkmale. Unveränderte Form des Kreuzes. Wirkliche Herkunft des Kreuzes. Das Kreuz im alten Amerika. Die Mond-Stadt. Das Malteserkreuz in vorchristlichen Zeiten. Dänische und indische Kreuze. Alte britische Kreuze. Ursprung des christlichen Kreuzes. Crux Ansata beschrieben. Alter desselben. Der Nil-Schlüssel. Phallische Abstammung. Die Nil-Schlüssel-Theorie analysiert. Das Kreuz in alter biblischer Zeit. Crux Ansata das Symbol der Symbole. Crux Ansata als religiöses Symbol.Es gibt wenige Dinge, über deren Herkunft, Bedeutung und Charakter so irrtümliche Meinungen, Annahmen und Lehrsätze herrschen und bestehen, wie über das Symbol des Kreuzes. Diesem Zeichen begegnen wir in der ganzen Welt, in allen denkbaren Formen, aus Holz geschnitzt, aus Stein gehauen, aus Metall getrieben, gegossen, gehämmert, geschmiedet, aus edlem und gemeinem Material, als Verzierung und Schmuck auf Gebäuden, in Gebäuden, auf Gräbern, in Feldern, von Personen getragen als persönlicher Schmuck oder als geheiligtes Schutzmittel (Amulett). So verschiedenartig nun die Form
des Symboles und seine Verwendung ist, so herrscht doch in christlichen Ländern eine übereinstimmende Ansicht über seine Herkunft und seine Bedeutung, und diese geht dahin, dass allgemein angenommen wird, d. h. dass es als erwiesene Tatsache hingestellt wird, dass das Kreuz christlichen Ursprungs sei, und ein ausschliessliches Symbol der christlichen Kirche ist!
Nichts ist irriger als diese Annahme und Behauptung. Nichts ist auch mehr geeignet, der Beurteilung der Religionssysteme falsche Bahnen zu geben. Denn in allen Teilen der Erde findet man Monumente, Ornamente, Symbole, welche die Form des Kreuzes haben, oder wenigstens einen kreuzähnlichen Charakter tragen, und lange vor der Verkündigung der christlichen Lehre existiert hatten.
Selbstverständlich muss scharf unterschieden werden zwischen dem Kreuz an sich, und dem Kruzi- fix — dem Kreuz mit dem Bild des Gekreuzigten —, dieses letztere Symbol, das Kruzifix, ist natürlich und ohne allen Zweifel ausschliesslich christlichen Ursprungs und ist ausschliesslich ein christliches Wahrzeichen und Symbol. Das Kreuz allein aber, obgleich es von den Bekennern der christlichen Religion zum ewigen Gedächtnis und zur Erinnerung an die Tatsache, dass der Begründer derselben durch das Kreuz und am Kreuze den Märtyrertod erlitten
hatte, zum christlichen Glaubenssymbol erhoben wurde, ist »heidnischen« Ursprungs, ist uralt und wird auf Denkmälern gefunden, die Tausende von Jahren vor Christi Geburt schon bestanden haben. Man findet das Kreuz, oder kreuzähnliche Formen, in allen alten Religionen, sobald selbe System annahmen, als ein heiliges oder geheiligtes Zeichen beziehungsweise Symbol.
An anderer Stelle ist auf die Ähnlichkeit verschiedener »heidnischer« Gebräuche und Glaubens- lehren hingewiesen, sowohl im Orient wie im Occident, und gleichviel ob selbe Hindus, Ägypter, Griechen, Briten oder Skandinavier waren, allen gemeinsam ist auch das Symbol des Kreuzes und dessen Verehrung.
Das Kreuz, als religiöses Symbol, bildet sozusagen das grosse elastische Band, das alle Völker des vorchristlichen Altertums zu einem gemeinsamen Körper zusammenschloss, gleichviel wie feindlich selbe sich sonst auch gegenüber stehen mochten. Das Kreuz war das urälteste Wahrzeichen einer universalen Brüderlichkeit oder besser eines Welt- Bruderbundes und der Hauptberührungspunkt in allen Systemen der vorchristlichen Mythologien.
Es war von urgrauer Zeit her das »grosse mystische Zeichen« über dem Irrgarten der Glaubensverschiedenheiten und der Systemstreitigkeiten, zu dem alle Menschen, einzeln oder in Gruppen, als
Familien oder als Nationen, mit unwiderstehlicher geheimnisvoller Macht hingezogen wurden, durch das ihnen ihr gemeinsamer Ursprung auf die eindringlichste und fasslichste Weise zum klaren Verständnis gebracht wurde, das ihnen in allen Lagen und Fährlichkeiten des irdischen Lebens zum Wahrzeichen der ursprünglichen Glückseligkeit und Würde der menschlichen Rasse war.
Diese unauslöschliche Wahrheit wurde uns nicht durch die geschriebene Geschichte (im gewöhnlichen Sinne des Wortes) überliefert, sondern durch die im gewissen Sinne unvergängliche symbolische Sprache von Kulturvölkern, deren Namen sogar schon im Meere der Vergangenheit untergegangen sind.
Jahrhunderte und Jahrtausende sind dahingegangen, Kontinente sind verschwunden und entstanden, kosmische und irdische Revolutionen haben stattgefunden, Völker sind mächtig geworden und haben sich auf den Schlachtfeldern verblutet oder sind im Wohlleben einer Überkultur verweichlicht und dahingesiecht, Zivilisationen haben sich abgelöst, Weltstädte sind zu Staub und Asche geworden, wo millionenfaches Leben herrschte, treibt der Wüsten- sand, aber allem Wechsel trotzten gewisse Wahrzeichen, mystische Hügel und Steindenkmäler, die Gräber von Königen, die Ruinen von Tempeln, geborstene Säulen, die letzten Fundamente verfallener Opferstätten u. s. w., die alle eine Sprache sprachen,
die, zuerst unverstanden, von wenigen erlernt, von den meisten ignoriert oder als trügerisch zurückgewiesen, eine Geschichte enthüllten, die nirgends in Worten und Buchstaben niedergeschrieben ist. Die Geschichte des Kreuzes. Auf allen und in allen diesen Denkmälern des urgrauesten Altertums wurde überall das Kreuz gefunden. Nicht nur in der rohen, einfachen Form, sondern in den denkbar künstlerischsten und idealsten Verwebungen und Zusammensetzungen, von der kleinsten Form bis zur mächtigsten ornamentalen Struktur. Diesem Kreuzeszeichen haftete eine derartige »Heiligkeit« an, und es war von einer so grossen mystischen Weihe eingeholt, dass die höchste menschliche Kunst und Arbeitskraft, sowie der grösste Reichtum in den Dienst des Kreuzes-Symbol und der Herstellung desselben gestellt wurden.
Das Verlangen nach künstlerisch vollendeter Darstellung des Symbols schuf Künstler und Kunstwerke! Die verschiedensten Völker mit den verschiedensten Kulten, verschiedensten Religionssystemen, verschiedenster Zivilisation, die verschiedensten Kasten und Bevölkerungsklassen, wetteiferten miteinander in Erreichung der möglichst pomphaften Darstellung und Verehrung des Symbols, und wirksamster Anpreisung seiner besonderen Tugenden und Eigenschaften. Die Wunder von Elephanta und Ellora mit deren
felsengehauenen Höhlen, die Tempel von Mathura und Terputty im Osten, die Wunder von Callerius und Newgrange im Westen, und die Tempel von Mitzla (der Mondstadt) in Zentral-Amerika (ebenso aus dem rohen Felsen gehauene Höhlen-Tempel, wie die in Indien sind) legen Zeugnis dafür ab, dass geographisch und räumlich vollständig getrennte, in Unwissenheit von einander lebende Völker, von denen jedes einen ganz unabhängigen, eigenen Entwicklungszug durchgemacht hat, ein und dasselbe grosse mystische Ur-Symbol anbeten, verehren, es künstlerisch darstellen und es zu perpetuieren versuchen.
Es gab viele »heilige Symbole« zu allen Zeiten und bei allen Völkern, aber kein Symbol war so allgemein verbreitet wie das Kreuz. Das Kreuz war »international«! Ob wir es als St. Andreaskreuz, als St. Georgskreuz, als Malteserkreuz, als griechisches Kreuz oder lateinisches Kreuz kennen, ist gleichgültig, es existierte in diesen und unzähligen anderen Formen längst vor Christus, erschien im ältesten Altertum und ist gemalt, oder auch bildnerisch dargestellt, aus urgrauem Altertum noch vorhanden.
Die Zeiten haben die Formen des Kreuzes wenig beeinflusst. Dynastien, Reiche, Rassen, Städte und Völker sind entstanden, haben geblüht und sind untergegangen, aber das Kreuz blieb sich gleich in allem Wechsel. Und dasselbe Wahrzeichen, das der Bildhauer des alten Babylons oder Niniveh auf
seine Statuen gemeisselt hat, oder das der alte Ägypter auf den Sarkophag oder die Mumienhülle des geweihten Toten gemalt hat als Zeichen und Symbol seiner religiösen Überzeugung, dieses selbe Zeichen und Symbol meisselt der moderne. Steinmetz auf die christlichen Grabstätten, in die christlichen Kirchen, der Kunsthandwerker schmiedet goldenes Geschmeide in Kreuzesform für hohe christliche Priester, oder der christliche Maler schmückt die Wände der christlichen Tempel mit dem Symbol!
Wenige Mitglieder der christlichen Kirchen oder Bekenner des christlichen Glaubens kennen diese oben niedergeschriebene Wahrheit über den Ursprung und die Herkunft des Kreuzes, das sie alle als ein ausschliessliches christliches Symbol betrachten, aber weder die christliche Kirche als solche, noch die Vertreter der einzelnen Bekenntnisse in der christlichen Kirche sind imstande, diese oben dargelegte Wahrheit aus der Welt zu schaffen, oder selbe zu verleugnen.
Der erleuchtete englische Geistliche Br.: Rev. Gould erklärte daher auch frank und frei: Ich sehe keinerlei Schwierigkeit darin, zuzugeben, dass das Kreuz einen Bestandteil der Urreligionen bildete, denn Spuren desselben findet man über die ganze Welt verstreut und bei allen Völkern.
Der Glaube und das Vertrauen in die Kraft des Kreuzes war ein Teil des ältesten Glaubens, der die
Menschheit an eine Dreifaltigkeit (Trinität) zu glauben veranlasste, nämlich an einen Krieg im Himmel, ein Paradies, aus dem die Menschen vertrieben oder gefallen waren, und an eine Flut und ein Babel. Einem Glauben, der tief durchdrungen war von der Überzeugung, dass eine »Jungfrau« sollte einen Sohn empfangen und gebären; dass des Drachens (Schlange, Lindwurm) Kopf sollte zertreten (zerschmettert) werden, und dass die Erlösung durch das Vergiessen des Blutes gewonnen werde! Die Deutung des Kreuzes als ein Symbol des Lebens und der Wiedergeburt durch Wasser ist so weit in der Welt verbreitet, wie der Glaube an die Arche Noahs. Es ist sehr wohl möglich, dass der Schatten des Kreuzes viel tiefer in die Nacht des Uraltertums hineinfällt und weitere Strecken Landes bedeckt, als wir annehmen oder wissen.
Es ist wohl mehr als Zufall, dass Osiris mit dem Kreuze den Geistern der Gerechten ewiges Leben gibt, dass mit dem Kreuze Thor den Kopf der grossen Schlange zerschellt, dass die Muysca-Mütter ihre kleinen neugeborenen Kinder unter das Zeichen des Kreuzes legen in der Hoffnung, selbe so vor bösen Einflüssen zu schützen, und dass mit dem Kreuze die alten Bewohner Norditaliens ihre Angehörigen in den Staub legten, um sie zu schützen.«
Eine gleiche freimütige Aussprache findet man kaum weder in Deutschland noch in England. In
manchen Freimaurerlogen wird vielleicht eine derartige Wahrheit mal erwähnt, im allgemeinen rührt man aber nicht gern an der christlichen Überlieferung.
Wenden wir unsere Aufmerksamkeit von Indien und dem Orient ab, und dem Occidente und den sogenannten westlichen Ländern zu, so finden wir, dass die Spanier, als sie auf ihren Eroberungszügen in Amerika Fuss gefasst hatten, nicht wenig erstaunt waren, das Zeichen des Kreuzes dort allgemein verbreitet und im Gebrauch zu finden, bei Völkern, die doch als absolut »heidnisch« betrachtet werden mussten. Die Spanier waren klug genug, die Gelegenheit zu ihrem eigenen Vorteil auszunutzen, und indem sie auf die Kreuze in ihren eigenen Fahnen und Standarten hinwiesen, sicherten sie sich von den Eingeborenen eine freundschaftliche Aufnahme, die den Eingeborenen nachträglich allerdings schlecht bekommen ist!
Dieses »christliche Zeichen« genoss bei diesen amerikanischen Völkerschaften grössere göttliche Verehrung als das Symbol des »Lebens« in Ägypten oder das Symbol der »Ewigkeit« in Indien.
Der Versuch ist gemacht worden, die Tatsache, dass in Amerika vor dem Erscheinen der christlichen Eroberer das Kreuz schon göttliche Verehrung genoss, wegzuleugnen. Man hat versucht, zu behaupten, dass das Kreuz erst durch die Spanier als Religionssymbol aufgekommen sei. Dieser Versuch
ist elend missglückt, da in den alten Tempeln der Ureinwohner Zentral-Amerikas nicht nur das Kreuz, sondern auch andere Symbole gefunden wurden, die mit Religionssymbolen der Völker Europas, Indiens, Ägyptens und Chinas derart übereinstimmen, dass es sofort klar ist, dass eine (uns bis jetzt unbekannte) Verbindung zwischen den religiösen Ansichten der Urvölker bestanden haben muss.
Der englische Forscher Stephens gibt in seinem Werk über Zentral-Amerika eine Abbildung eines dieser »heidnischen« Kreuze, die vor dem Erscheinen der Vertreter der christlichen Religion dort existiert haben. Er fand dieses Kreuz, das ungefähr zehn Fuss hoch ist, in die Wand eines zerfallenen Tempels in Palenque gemeisselt. Auf jeder Seite des Kreuzes steht eine menschliche Figur, eine davon hält ein Kind in die Höhe, als ob sie es dem Kreuze weihen wolle, und beide Personen trugen auch auf ihren Kleidern Kreuze als Schmuck.
Es ist daher gar kein Zweifel, und hervorragende profane Forscher haben es auch zugegeben, dass diese Kreuze nicht nur in Amerika, sondern auch in anderen Ländern lange vor der christlichen Zeit existiert haben, und als Glaubens- oder Religionssymbole verehrt wurden. Ein merkwürdiger Gebrauch herrschte in Mexiko. Bei gewissen Festen formten die Priester aus Mais und dem Blute der geopferten Tiere (manchmal auch von Menschen)
Kreuze. Diese Kreuze wurden unter besonders feierlichen Zeremonien von den Priestern geweiht und dem Volke gezeigt, damit es denselben gött- liche Verehrung zolle. Danach zerschlugen oder brachen die Priester die so hergestellten und geweihten Kreuze entzwei, verteilten die kleinen Stücke unter das Volk, welche dieselben gierig verschlangen als ein Symbol der Bruderschaft, und zum Zeichen der Knüpfung eines feierlichen Bandes der Freundschaft.
In der oben erwähnten Stadt des Mondes (Mitzla) sind auch zahlreiche Kreuze in den zerfallenen Tempeln und bei den Eingeborenen als Hauseigentum gefunden worden.
Diese kleinen Kreuze wurden anfangs für Münzen gehalten. Sie waren aus einem Metall, das unserem Blech ähnlich war, und waren entweder ausgestanzt oder das Kreuz war in eine runde Scheibe geprägt respective geschlagen. Später fand man, dass diese kleinen Zeichen als Amulette getragen worden waren. Der gleiche Gebrauch herrschte auch bei den Ägyptern. Die Schari, ein assyrischer Volksstamm, trugen kleine Kreuze an ihren Halsbändern um den Hals oder an den Kragen ihrer Kleidungsstücke. Die Rotunos, ein lydisches Volk, trugen Stoffkreuze auf ihren Kleidern. Aus diesen Thatsachen geht hervor, dass diese afrikanischen Völker 1500 Jahre vor der Geburt Christi das Kreuz getragen haben.
Aber auch in Europa findet man das Kreuz
vor der christlichen Zeitrechnung, das heisst vor der Geburt Christi, insbesondere bei den Skandinaviern, Kelten, Cimbern u. s. w., denn in Schweden, Norwegen, Russland, Irland, Cornwall sind Kreuze und kreuzförmige Symbole ausgegraben worden. Die ausgegrabenen vorchristlichen Symbole korrespondieren genau mit den christlichen Formen.
Besondere Erwähnung verdient das Malteserkreuz. Die Form des Malteserkreuzes ist so allgemein bekannt, dass es hier nicht erst beschrieben zu werden braucht. Das Malteserkreuz wird heute noch vom Papste als hoch geschätzte Auszeichnung an verdiente oder hochstehende Mitglieder der katholischen Kirche verliehen. Dieses Kreuz hat seinen Namen daher, dass seine besondere Form aus Malta stammt. Man hatte dort vier grosse Phalli in Kreuzesform aus hartem Granit gemeisselt, die in der Mitte auf einem Kreise standen. Die späteren Ritter des Malteser-Ordens oder St. Johannis-Ritter von Malta änderten die Form des Kreuzes dahin, dass sie die vier Arme oder Phalli in vier Dreiecke verwandelten, welche mit der Spitze auf dem Kreise in der Mitte ruhen. Dieses Kreuz hat auch grosse Bedeutung in der Freimaurerei, besonders in der sogenannten Hochgrad-Maurerei, die die Templer-Tradition perpetuiert.
Auf der Insel Gozzo, die in der Nähe von Malta liegt, fand man zahlreiche Kreuze aus Phalli darge-
stellt. Dieselben stammten aus der Zeit der Phönizier. Man findet die gleichen Darstellungen auch auf etruskischen und pompejanischen Denkmälern.
In Assyrien scheint das Kreuz hauptsächlich als Abzeichen der königlichen Gewalt getragen worden zu sein. Man findet es dargestellt auf der Brust der mächtigsten Herrscher von Babylon und Ninive. Die Könige trugen auch das Kreuz zusammen mit anderen Abzeichen um den Hals. Beweise dafür findet man auf allen assyrischen Skulpturen in den Museen der europäischen Hauptstädte.
In Assyrien stellte das Kreuz die vier Hauptgötter vor: Ana, Belus und Hea. Bei den Römern war es ein Zeichen des Lebens. Saturns Symbol war ein Kreuz mit dem Horn des Widders; Jupiters Zeichen war ebenfalls ein Kreuz mit einem Horn, und das Zeichen der Venus war ein Kreis mit einem Kreuz.
Im alten Indien wurden die Tempel der »heidnischen« Hindus ebenso in der Form eines Kreuzes gebaut, wie später die christlichen Kathedralen und Kirchen. Zwei der wichtigsten und berühmtesten Pagoden, nämlich die zu Benares und zu Mathura, sind nach dem Grundriss eines Kreuzes gebaut.
In Dänemark fand man unter den Steinwaffen und Steinwerkzeugen die kreuzförmigen Hammer. Das Attribut des Gottes Thor ist der kreuzförmige Hammer, mit dem nicht nur die dem Thor dar-
gebrachten Opfer erschlagen wurden, sondern mit dem er auch manchmal eingegangene Ehebündnisse segnete.
Auf den britischen Inseln, bei den irischen und gallischen Kelten war das Kreuz ein allgemein verbreitetes Symbol. Das Wahrzeichen Irlands (the shamrock of old Ireland), das Kleeblatt, empfing seinen geweihten Charakter dadurch, dass es als Kreuzzeichen angesehen wurde. Und bei den Druiden hatte das Trifolium von jeher seine besondere mystische Bedeutung. Indem somit keinerlei Zweifel mehr darüber sein kann, dass das Kreuz kein ausschliesslich christliches Symbol ist, sondern als Zeichen des Lebens und der ewigen Wiedergeburt tausende von Jahren vor der Geburt Christi gegolten hat, bleibt nur noch übrig darauf hinzuweisen, dass das Kreuz auch ein phallisches Symbol ist, worüber ausführlich und eingehend später noch geschrieben werden wird.
An dieser Stelle genügt es vorläufig zu konstatieren, dass der Querbalken — des Kreuzes das passive Element, das weibliche Reproduktionsorgan, darstellt, und der senkrechte Balken | stellt das aktive Element, das männliche Reproduktionsorgan, dar. Die Vereinigung der beiden zum Kreuze ✝ ist Lingam-Yoni, die Vereinigung von männlich und weiblich, von positiv und negativ, von passiv und aktiv oder ein Symbol der mystischen Hochzeit.
Das eigentümlichste und bemerkenswerteste Kreuz ist jenes Kreuz, das man auf allen Denkmälern Ägyptens sieht, nämlich das Henkelkreuz oder Crux Ansata. Es besteht aus einem griechischen Tau oder T mit einem Ring O oben darauf und sieht so aus ☥. Der Ring ist manchmal ganz kreisrund, meistens aber eher von etwas ovaler O Form, und davon hat das Kreuz seine Bezeichnung Henkelkreuz oder Crux Ansata.
Schon Sokrates, Sozomen und andere weise Männer des Altertums befassten sich mit der Erklärung des Crux Ansata, und bis auf den heutigen Tag sind die Vertreter der Schulwissenschaft mit ihren Deutungen nicht einig geworden. Die Ägypter erklärten auf alle Fragen, dass das Tau mit dem Kreis ein göttliches Mysterium darstellte, und ein Mysterium und ein Geheimnis ist dieses Symbol allen Profanen und Nichteingeweihten bis heute geblieben.
Wie schon oben gesagt wurde, findet man das Henkelkreuz auf allen Denkmälern Ägyptens und zwar in den Händen der Isis, des Osiris und anderer Götter. Man findet es aber auch auf den Skulpturen von Ninive, auf den Elfenbeintafeln von Nimrods Palast und in den Höhlentempeln in Indien.
Als im Jahre 389 auf Befehl Theodosius’ das Serapeum, der Tempel des Serapis, zu Alexandrien zerstört wurde, lernten die Christen zum ersten Male
dieses Kreuz unter den ägyptischen Hieroglyphen kennen. Sie deuteten es als eine vorchristliche Prophezeiung vom Kommen Christi, und von der Zeit an (so wird berichtet) sollen die Christen das Wahrzeichen und Symbol der Erlösung durch Christi Tod nach diesem Henkelkreuz geformt haben. Nach dieser Zeit findet man das Henkelkreuz auf christlichen Denkmälern, und viele nahmen an, dass es das Urbild des Monogramms Christi sei. Das ist aber nicht richtig, da letzteres lange vor der Zerstörung des Serapeum schon bekannt und im Gebrauch gewesen war. Obgleich schon gesagt wurde, dass das Crux Ansata ein göttliches Mysterium, ein Geheimnis, nämlich: Schöpfung, Zeugung von Leben, ewiges Leben bedeutet, so sollen doch auch andere Deutungen erwähnt werden.
Man hat es als zwei griechische Buchstaben Phi, Tau gedeutet, die für Ptha, einem Namen Merkurs, gelten sollen. Man hat es auch als einen »Schlüssel« bezeichnet, den Merkur mit sich führte, um den abgeschiedenen Seelen, deren Führer er im Lande der Schatten war, die Tore ins bessere Jenseits zu öffnen. Manche Gelehrte halten heute noch an der Bezeichnung als »Schlüssel« fest, indem sie sich auf Stellen in der Bibel beziehen. Im Buche des Propheten Jesaias heisst es Kapitel 22, Vers 22: »die Schlüssel des Hauses David will ich auf seine Schultern legen,« und im Buche der Offenbarungen: »und
ich habe die Schlüssel der Hölle und des Todes.« Daraus soll der Schluss gezogen werden, dass das Henkelkreuz in der Hand der ägyptischen Gottheiten ein Schlüssel war, der denselben die Macht gab, die Menschen in den Himmel einzulassen oder sie von der Gemeinschaft der Seligen auszuschliessen.
Man hat das Henkelkreuz auch »Nil-Schlüssel« genannt, und es wird von vielen Gelehrten auch heute noch so genannt. Es sollte ein Instrument sein, um den Abfluss der Wasser des Nils in die durch ihn gespeisten Seitenkanäle zu regulieren. Bekanntlich hängt und hing die Fruchtbarkeit Ägyptens und damit der Wohlstand des ägyptischen Volkes vom Stande des Nilflusses ab. Es war das wichtigste Amt des Landes, dafür zu sorgen, dass beim Steigen des Flusses die Schleusen der Bewässerungskanäle rechtzeitig geöffnet wurden. So wichtig nun auch das Messen des Niles und das Öffnen der Schleusen war und heute noch ist, so ist diese so beliebte Deutung des Crux Ansata als »Nil-Schlüssel« doch viel zu trivial, um hier weiter behandelt oder beachtet zu werden.
Würdiger und der Wahrheit näher kommend ist die Deutung, dass der Kreis den Schöpfer und Erhalter des Weltalls symbolisiert, und dass die aus ihm entspringende Weisheit der Regierung des Weltalls durch das Tau, dem Monogramm Merkurs, des Thoth oder Theta, Tau, Ptha, dargestellt ist.
Die wirkliche geheime Bedeutung des Crux Ansata ist (wie das bei allen derartigen Mysterien der Fall ist) eine doppelte. Exoterisch wurde es dem Neophyten als ein Altar, auf dem ein Ei (Weltei) ruht, erklärt. Esoterisch hat es aber die folgende Bedeutung. Nach dem bekannten okkulten Satz: was oben ist, ist unten, und was unten ist, ist oben, ist das Symbol, esoterisch betrachtet, umzukehren ⊥, so dass der senkrechte Balken das män- nliche Prinzip, der wagerechte Balken das weibliche Prinzip im Akte der Vereinigung mit dem männlichen Reproduktionsorgane und der Kreis oder das Ei das Produkt der Vereinigung, das durch den Akt hervorgerufene geschaffene Leben, darstellt, so dass ☥ das umgekehrte Henkelkreuz, genau wie das gleichseitige Dreieck mit dem Jod in der Mitte, oder dem Lingam-Yoni, das Symbol der Schaffung alles Seienden, der Quelle alles Lebens, das Symbol Schivas, das Symbol Osiris, das Symbol der Dreiheit in der Einheit ist! Als solches wurde es schon vor tausenden von Jahren als das Symbol aller Symbole bezeichnet, das mystische Tau, das »grosse Geheimnis« oder »grosse Mysterium«, die »verborgene Wahrheit«, das »verschleierte Bild« nicht allein der Ägypter, sondern auch der Chaldäer, Phönizier, Mexikaner, Peruvianer und aller Kulturvölker des grauesten Altertums in beiden Hemisphären dieser Erde.
Als Buchstabe T mit dem Ei O war dieses Ge-
heimnis eingegraben auf der Riesenstatue des Serapis, welche 293 vor Christi Geburt auf Befehl von Ptolemäus Lage von Sinope, an der Küste des schwarzen Meeres, nach dem Labyrinth am Moeris-See gebracht und dort auf Befehl des Theodosius von dessen siegreichem Heere im Jahre 389 nach Christi Geburt zerstört wurde. Die ägyptischen Priester flehten die siegreichen Heerführer um Schonung ihres höchsten Mysteriums, dem Symbol der lebenspendenden Gottheit, an, aber all ihr Bitten und Flehen war umsonst. Es wird berichtet, dass diese zwecklose Zerstörung eines der höchsten Heiligtümer des ägyptischen Volkes nicht ohne Folgen für die Eroberer geblieben sei.
Es ist ganz klar, dass das Henkelkreuz, ganz abgesehen von seiner mystischen, esoterischen Bedeutung, für das ägyptische Volk ein religiöses Symbol und auch das Abzeichen königlicher Gewalt war. Der Grundriss vieler ägyptischer Tempel ist nach dem Muster des Henkelkreuzes angelegt. Bei dem Bau der Grabkammern diente das Henkelkreuz auch als Vorbild. Das Henkelkreuz wurde als Feldzeichen dem ägyptischen Heere vorangetragen, unter Hinzufügung der Abbildung irgend eines Tieres diente es als Wappenzeichen für die Städte. So war das Henkelkreuz mit einem Löwen das Wappenzeichen der Stadt Leontopolis, das Kreuz mit einem Ziegenbock das Wappenzeichen der Stadt Panopolis u. s. w. Man stempelte auch die Abzeichen heiliger Tiere
mit dem Kreuze, und so wurden sie dann als Amulette getragen.
Das Bemerkenswerteste ist aber, dass man dieses Kreuz nicht nur in den Tempeln und Katakomben von Aegypten, sondern auch in den Ruinen der Städte und Tempel von Mexiko und Zentral-Amerika findet. Besonders schön erhalten sind die Kreuze, die man auf den unzähligen Bronzestatuetten im Friedhof von Jingalpa in Nicaragua eingeprägt gefunden hat. Die ausgegrabenen Bronzestatuetten tragen das Kreuz auf der Brust.
Das Zeichen, das die Kinder Israels auf Moses Befehl an ihre Thüren malten, um die Erstgeborenen vor dem Todeseengel zu schützen, war das Henkelkreuz. Es war auch das Zeichen, das diejenigen Männer, die, nach Ezechiel, Kap. 9, V. 4, nicht erschlagen werden sollten, auf der Stirne trugen.
KAPITEL VII.
Die Hebräer und der Phalluskultus. Salomon und die fremden Götter. Das alte Testament und die Phallusidee. Der Gottesdienst in Hainen. Geweihte Säulen. Aschtoreth oder Ascherah und die Haine. Jüdischer Götzendienst. Salomons Götzendienst ein Lingam-Yoni-Kultus. Der Baalsgötzendienst. Baal ist Lingam-Yoni. Maachas Gottheit war der Priapus.Verschiedene Stellen des alten Testaments weisen auf die Beziehungen der Hebräer zum Phalluskultus hin. Im ersten Buche der Könige, Kap. 11, Vers 5, heisst es in Luthers Uebersetzung: »Also wandelte Salomo Aschtoreth dem Gott derer von Zidon nach und Milkom dem Greuel der Ammoniter.« Ferner Vers 33: »Darum, dass sie mich verlassen und angebetet haben, Aschtoreth, den Gott der Zidioner, Camos, den Gott der Moabiter, und Milkom, den Gott der Kinder Ammons.« Diese Stellen des alten Tempels legen Zeugnis ab von Salomons Götzendienst. Und dieser »Götzendienst« war eben Geschlechtskultus, Phalluskultus, göttliche Verehrung von Lingam- Yoni. Salomon verliess den Dienst des »Gottes seiner Väter« und betet »fremde Götter« an! Diesem »Götzendienst« wurden »Haine« errichtet und geweiht, und im Schatten dieser Haine artete der Dienst der fremden Götter in die wildesten geschlechtlichen Orgien aus. Josiah, der neue König, liess die Haine niederhauen und verbrennen und die Orte des Götzendienstes bis auf den Grund zerstören. Dieser Götzendienst in Hainen ist darauf zurückzuführen, dass die meisten sogenannten heidnischen Völker dem »grossen, unbekannten Gotte« fast ausschliesslich im Freien unter Bäumen oder auf Hügeln dienten und ihm ihre Opfer darbrachten. Für die meisten war die Sonne als Symbol des aktiven zeugenden Naturprinzipes die oberste und höchste Gottheit, und da sie sich keinen Tempel gross und weit genug vorstellen konnten, der die Sonne umschliessen oder einschliessen könnte, so dienten sie der Sonne ausserhalb der Mauern der Tempel, indem sie sagten, die ganze Welt ist ein Tempel der Sonne! Man hat aber ausser der Sonne noch andere Gottheit gehabt, deren »Unbegrenztheit« man dadurch andeutete, dass deren Tempel
kein Dach hatten, so z. B. der Tempel des Terminus. Ausser den Hainen waren die Hügel und Berge sehr bevorzugt, weil man annahm, dass man auf den Hügeln und Bergen der Gottheit näher wäre. Die Haine wurden derartig angelegt, dass die Bäume nicht nur Hallen und Dome bildeten, sondern auch kleine Nischen und Kammern aus Sträuchern und Laubgewächsen, in deren Schatten und unter deren Schutze die sexuellen Riten des Götzendienstes stattfanden. Dass dieser »Götzendienst« ein Phalluskultus war, und dass das Wort »Hain« des Uebersetzers eine Umschreibung der göttlichen Verehrung des Lingam- Yoni war, geht aus dem II. Buch der Könige, Kap. 23, hervor. Es heisst da nach Luthers Uebersetzung: König Josias Eifer … Vers 4: »Und der König gebot, dass sie sollten aus dem Tempel des Herrn tun alles Zeug, das dem Baal und dem Hain und allem Heer des Himmels gemacht war. Und verbrannten sie aussen vor Jerusalem. … Vers 5: »Und er tat ab die Camarim, welche die Könige Juda hatten gestiftet, zu räuchern auf den Höhen, in den Städten Judas und um Jerusalem herum, und die Räucherer des Baals, und der Sonne und des Mondes, und der Planeten.« … Vers 6: »Und liess den Hain aus dem Hause des Herrn führen, hinaus vor Jerusalem, und verbrannte ihn im Bache Kidron.« … Vers 7: »Und er brach ab die Häuser der Huren, die an dem Hause des Herrn waren, darinnen Weiber wirkten Häuser zum Hain!«
Es ist ganz klar, dass diese Weiber nichts anderes waren als die »Kunchnee Lug« der Hindus, von denen im 3. Kapitel dieses Buches die Rede war. Luther hat eben in seiner derben deutschen Art die
derbsten Ausdrücke für diese im Dienste dieser Gottheit absolut notwendigen Personen gewählt.
Als weitere Bestätigung des Lingam-Yoni-Kultus bei den Hebräern dienen folgende Verse aus dem alten Testamente: I. Buch Könige, Kap. 14, Vers 15: »Denn sie (das Volk Juda) bauten ihnen (den fremden Göttern Lingam und Yoni) auch Höhen, Säulen und Haine auf allen hohen Hügeln und unter allen grünen Bäumeln.« – II. Buch Könige, Kap. 23, Vers 13: »Auch die Höhen, die vor Jerusalem waren, zur Rechten am Berge Mashith, die Salomon gebaut hatte der Astoreth.« … Vers 15: »Auch den Altar zu Beth-El, die Höhe, die Jerobeam gemacht hatte, verbrannte der Hain!«
Aus den Texten des I. und II. Buchs der Könige, Kap. XIV, XV, XXII, XXII, und, und den Zeugnissen des Rabbi Solomon Jarchi geht es klar hervor, dass das »Götzenbild« ein Priapus war, oder wie es im lateinischen Text heisst »ad instar membri virilis«. Zu bemerken wäre nur noch, dass (wie bei den späteren Gnostikern) die Gottheit »Baal« sowohl männlich wie weiblich war. Diese Gottheit wurde im Gebet angerufen wie folgt: »Höre uns, gleichviel ob du ein Gott oder eine Göttin bist!«
Im nächsten Buche, der zweiten Abteilung des Gesamtwerkes »Lingam-Yoni«, werden die Beziehungen des Lingam-Yoni-Kultus zum Marienkultus und zu den Symbolen der Rosenkreuzer und Freimaurer behandelt werden.
Die Verlagsbuchhandlung »Schönheit« in Berlin S. W. wird eine Luxus-Ausgabe dieses Werkes herstellen lassen.
Ende des I. Buches.
Transkription September 2025: ChatGPT

[AI generiertes Image]
Deutsche Vollversion:
Deutsch: Lingam-Yoni, Teil II.
|
Theodor Reuss: "Lingam-Yoni oder Die Mysterien des Geschlechts-Kultus", facsimile re-print of the integral text by A.R.W. Hiram-Edition 14 1983 Gunta-Stölzl-Str. 9 D - 80807 München Deutschland / Germany Online ordering via email |
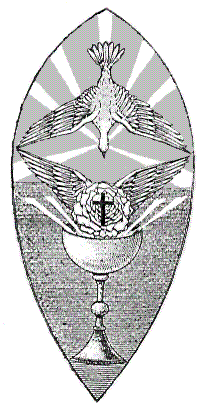 | Theodor Reuss . Ordo Templi Orientis . Memphis Misraim . Alter Angenommener Schottischer Ritus . Ancient Accepted Scottish Rite . Martinismus . Cerneau . Swedenborg. See charters, magazines, photographs and many more |
- English version: O.T.O. — Early Years and Development.
- Deutsche Version: Zur Geschichte des Ordo Templi Orientis.
- Versione italiano: Ordo Templi Orientis — I primi anni e la sua evoluzione.
- Traduction française: L’ancien O.T.O. et son évolution.
- Traduccion castellano: O.T.O. — Original y su Desarrollo.
|
O.T.O. Phenomenon navigation page | main page | mail What's New on the O.T.O. Phenomenon site?
|